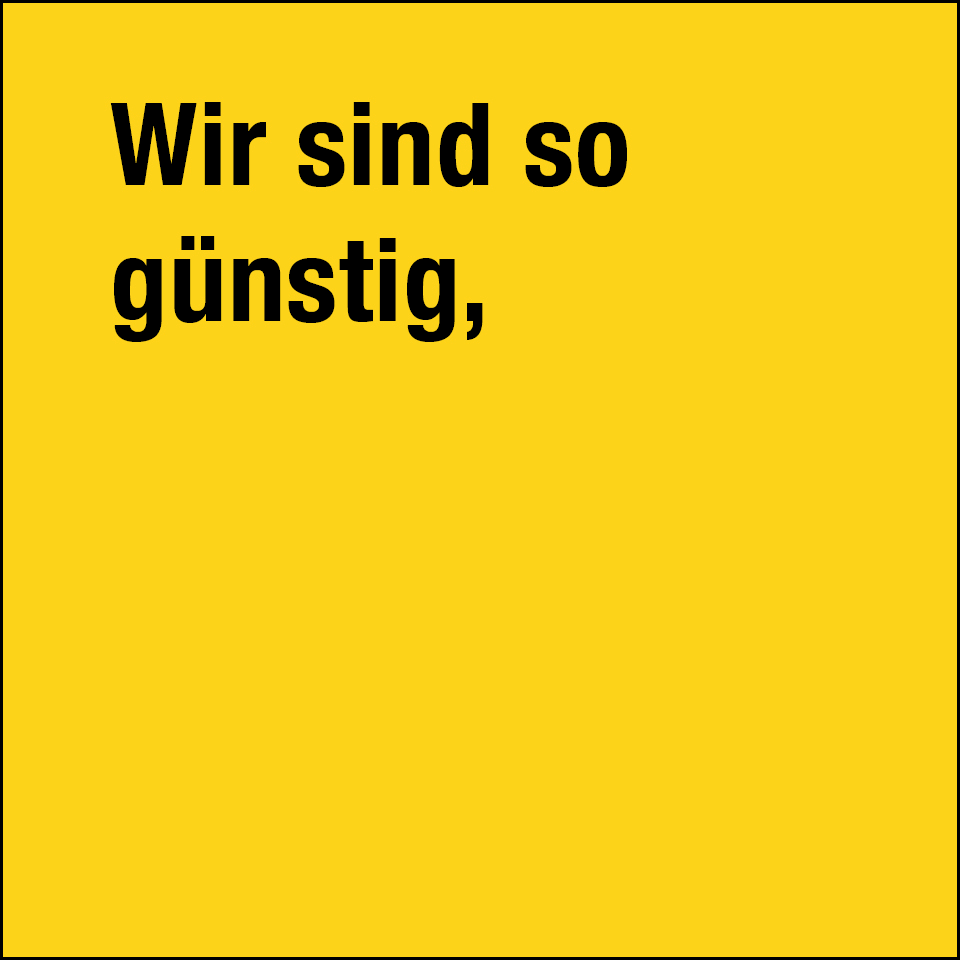Die Schlagzeilen rund um die Regensburger Korruptionsaffäre waren in den letzten dreieinhalb Jahren enorm, und nicht selten hagelte es Kritik vonseiten der Angeklagten – allen voran von Joachim Wolbergs. Aus der scheinbar notwendigen Beziehung zwischen Wolbergs und den Medien wurde so schnell eine verhängnisvolle Symbiose im Kampf um … Ja, um was eigentlich?
Er erinnert ein bisschen an den Panther in Rainer Maria Rilkes gleichnamigem Gedicht, als die Staatsanwaltschaft Anfang Mai ihr Plädoyer vorträgt: „Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe / so müd geworden, dass er nichts mehr hält. / Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt.“ Scheinbar apathisch nimmt Joachim Wolbergs den Schlussvortrag der Anklage hin, um sich nur Minuten nach Verlassen des Gerichtskäfigs wieder mit kühlem Kopf und in staatsmännischer Manier vor der Presse zu präsentieren: „Diese Staatsanwälte in diesem Verfahren haben ein Jagdbewusstsein und ein Vernichtungsbewusstsein. Und sie haben definitiv kein Rechtsbewusstsein.“ In diesen Worten kommt die andere Seite des Wolberg’schen Naturells zum Vorschein, die seit Beginn der Regensburger Korruptionsaffäre auch immer wieder aufkeimt und dem resignierend wirkenden Panther den Kampfgeist eines Politikers zur Seite stellt. Zusammengenommen ergibt sich aus diesem Konglomerat – bestehend aus der impulsiv-emotionalen Gemütslage der Privatperson Wolbergs im Saal 104 des Landgerichts Regensburg und der den kühlen Kopf bewahrenden Person im öffentlichen Leben – eine polarisierende Mischung, die nicht nur ordentlich Sprengpotential besitzt, sondern auch explodieren kann, sobald sie in die Hände von Journalisten gerät. Eine anscheinend lebensnotwendige Beziehung entpuppt sich plötzlich als eine verhängnisvolle Symbiose, in der zwar unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, letztendlich aber dasselbe Ziel verfolgt wird.
Vier Jahre und sechs Monate Haft versus Freispruch – das ist der Stand vor Gericht Ende Mai. Die Forderung der Staatsanwaltschaft auf der einen, die der Wolbergs-Verteidigung auf der anderen Seite. Wie der Fall letztendlich ausgeht, will das Gericht Anfang Juli entscheiden. Neben den sieben Themenkomplexen rückten im Laufe der Plädoyers und der mittlerweile fast drei Jahre andauernden Affäre auch wiederholt die Berichterstattungen der Medien in den Fokus – sowohl inner- als auch außerhalb des Gerichtssaals. Die Staatsanwaltschaft sieht diese nicht als strafmildernd an, die Verteidigung hingegen bezichtigt einige von ihnen regelmäßig der Vorverurteilung – gerade im Hinblick auf die Schilderungen zu Beginn der Ermittlungen gegen den mittlerweile suspendierten Oberbürgermeister. Es ist ein Begriff, der im eigentlichen Korruptionsprozess auch immer wieder von Wolbergs‘ Anwälten für die Verteidigung ihres Mandanten herangezogen wird. Zu Recht? Das ist nur eine von vielen Fragen, die es im Verhältnis zwischen Wolbergs und den Medien zu beleuchten gilt. Denn die treibende Kraft hinter dieser verhängnisvollen Symbiose ist trotz Vorwürfe und Feindschaften dieselbe. Doch der Reihe nach.
Es gibt vor allem zwei Beispiele, die im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Vorverurteilung im Wolbergs-Prozess immer wieder angeführt werden. Eines davon ist der Don-Corrupto-Aufkleber, der nach Bekanntwerden der Ermittlungen gegen das damalige Stadtoberhaupt zahlreiche Laternenmasten, Briefkästen und Dachrinnen in Regensburg zierte. Darauf zu sehen: ein Schwarz-weiß-Konterfei des damals noch im Amt befindlichen Oberbürgermeisters, rechts daneben der Schriftzug „Don Corrupto“. Dass der Sticker wohl eine Anspielung auf die Korruptionsvorwürfe gegen Wolbergs sind, vermuteten auch die Ermittler. Die Stadt erstattete damals zudem Anzeige gegen Unbekannt – aus Gründen des Vorwurfs der Beleidigung und zum Schutz der Position des Oberbürgermeisters: und das absolut zu Recht. Das zweite Beispiel ist eine Fotomontage. Sie zeigt Wolbergs’ Kopf – lächelnd – auf dem leblosen Körper von Uwe Barschel, als dieser tot in der Badewanne liegt. Die Vorlage dafür ist einer der berühmtesten Politskandale Deutschlands. Uwe Barschel, damals CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, versuchte im Zuge der Landtagswahlen 1987 seinen politischen Kontrahenten Björn Engholm von der SPD mit Hilfe von perfiden Tricks wie Bespitzelung aus dem Rennen ums Ministerpräsidentenamt zu werfen. Am Vorabend der Wahl kamen die Vorwürfe gegen Barschel ans Licht, die CDU verlor die absolute Mehrheit, und die einstige Lichtgestalt Barschel geriet in Erklärungsnot. Am 18. September folgte schließlich der Höhepunkt in Form einer Pressekonferenz, in der Barschel per „Ehrenwort“ besiegelte, dass die Vorwürfe gegen ihn haltlos seien – ohne Erfolg, denn er wurde als Lügner überführt. Barschel trat daraufhin zwar als Ministerpräsident zurück, fühlte sich jedoch trotz der Beweislage als Opfer einer Intrige. Am 11. Oktober fand ihn ein Stern-Reporter tot im Zimmer eines Genfer Hotels. Ob es Selbstmord war oder nicht, ist bis heute nicht geklärt. Barschel lag lediglich leblos in eben just jener Badewanne, in der die Regensburger Stadtzeitung nun Wolbergs legte.
Manchmal muss sie schwingen, die Moralkeule
Vorverurteilung ist ein mediales Problem, was nicht nur große prominente Beispiele wie der Fall Jörg Kachelmann belegen, sondern auch die genannte Fotomontage. In dubio pro reo – es gilt die Unschuldsvermutung, egal wie erdrückend die Beweislage zu sein scheint und egal, wen sie betrifft. Punkt. Im Journalismus gebietet das allein die Einhaltung der Publizistischen Grundätze des Deutschen Presserates, wo es unter Ziffer 13 heißt: „Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse.“ Doch Vorverurteilung hin oder her – was die Regensburger Stadtzeitung in Form dieser Fotomontage fabrizierte, ist Hetze. Geschmacklos, makaber, plump und nicht zuletzt einfallslos. Schließlich hatte das Satiremagazin Titanic bereits im April 1993 das Gesicht des neuen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Björn Engholm, auf das Barschel-Bild gebastelt und musste diesem dafür Schadensersatz in Höhe von 40.000 Mark bezahlen. Ähnlich wie bei Titanic hat auch der Angriff auf Wolbergs mit Satire oder gar Qualitätsjournalismus – dessen Verlust die Stadtzeitung wohlgemerkt bei anderen Medien gerne mal moniert – nichts zu tun. Es ist ein Pamphlet und eine Hetze, die – politisch oder persönlich motiviert sei dahingestellt – auch nach Veröffentlichung der Fotomontage fortgeführt wird und dabei eines offenbart: wie Sprache zur propagandistischen Diffamierung einer vermeintlich missliebigen Person missbraucht wird. Egal ob „Warmduscher“ oder „Totalversager“ – es ist eine Diffamierung basierend auf einem Krawallmodus in Manier seines scheinbar großen Vorbildes mit den vier großen Buchstaben, auch wenn die Regensburger Stadtzeitung zumindest rein rechnerisch mehr Lettern aufs Titelblatt bringt. Komplexe Sachverhalte werden auf ein unzureichendes Gut-Böse-Weltbild reduziert, es ist stets laut, skandalös, boshaft und nicht zuletzt vor allem eins: fremdschämend.
Ein Satz, in dem Gazette’sche Hybris und Rezipient’sche Verwunderung geradezu kollidieren, ist jener, in dem mit Blick auf Wolbergs‘ angeblichen Charakterzügen und unter Verweis auf Psychologen erklärt wird, dass sich die Grundstruktur eines Menschen nie ändern würde, was eben das Beispiel des suspendierten Stadtoberhauptes deutlich zeigen würde. Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt in der Psychologie auch ein Konzept, das für diese und viele weitere Behauptungen aus der Regensburger Stadtzeitung trefflich erscheint und das gemeinhin als Abwehrmechanismus definiert wird. Die Rede ist von Projektion, also die Zuschreibung oder Übertragung von versteckten oder offenen Schwächen oder Problemen der eigenen Person auf andere Menschen. Ergo: Man unterstellt einem Gegenüber Ängste, Sorgen oder Themen des eigenen Selbst – und ist obendrein auch noch von dieser eigens hergestellten Wahrnehmung überzeugt. Man schließt also von sich auf andere. Mal ganz zu schweigen davon, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens verschiedene Entwicklungsstufen durchläuft oder vielmehr durchlaufen sollte. Denn in diesem Fall scheint eher ein altes, leicht modifiziertes Sprichwort zuzutreffen: „Was Heinzelmännchen nicht lernt, lernt Heinzelmann nimmermehr.“
Der Vorverurteilung auf der Spur
Die wenigsten Medien, die über die Regensburger Korruptionsaffäre berichten, ziehen an diesem Strang bestehend aus Boshaftigkeit, Beleidigung und Bloßstellung. Und das hat nichts mit Konturlosigkeit zu tun, sondern mit journalistisch-ethischen Grundsätzen wie sie der Deutsche Presserat 1973 festgelegt hat. Auch wenn sein Werk – der sogenannte Pressekodex – aufgrund der fehlenden Gesetzmäßigkeit gemeinhin als zahnloser Tiger bezeichnet wird, bietet er dennoch Richtlinien, an die sich seriöser Qualitätsjournalismus halten sollte und auch hält. Wolbergs‘ Ansicht zum Trotz. Journalisten stehen nun mal in der Pflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, gerade über politische Themen. Und das impliziert eben auch die Interpretation von Sachverhalten und Problemen, gerade wenn es um eine Sensation geht, die die Regensburger in diesem Ausmaß noch nicht erlebt haben: Die Staatsanwaltschaft erhebt Vorwürfe gegen den regierenden Oberbürgermeister, der zuvor mit überragender Mehrheit zum Stadtoberhaupt gewählt worden war. Sie erhebt Anklage und unterrichtet auf einer umstrittenen Pressekonferenz die Medienvertreter über die einzelnen Punkte und ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse. Der vorläufige Höhepunkt bis dahin: Wolbergs kommt in Untersuchungshaft. Der OB beteuert zwar seine Unschuld, will sich erklären, schweigt dann aber doch – auf Anraten seiner Anwälte, wie sein aktueller Anwalt Peter Witting während seines Plädoyers schildert. Den Medien stehen somit vor allem die Anklagepunkte und die Ausführungen der Staatsanwaltschaft zur Verfügung, die zweifelsohne aufsehenerregend sind. Und die gilt es nun einzuordnen – nicht um Wolbergs wie „die bekannte Sau durchs Dorf“ zu treiben, wie Witting im Gericht ruft, sondern um zu informieren und um den Regensburgern eine Einordnung des Geschehenen zu liefern.
Eine Schlagzeile, die Witting während seines Schlussvortrags anspricht und mit denen er beweisen möchte, dass sich die Medien auf seinen Mandanten regelrecht gestürzt hätten, lautet: „Wolbergs versinkt im Spendensumpf“. Die Suche im Netz führt zu einem Beitrag vom 8. November 2016 mit ähnlichem Wortlaut: „Regensburgs Oberbürgermeister versinkt im Spendensumpf“. Eine Verurteilung Wolbergs‘ im Vorfeld des Prozesses ist darin allerdings nicht zu erkennen. Es wird – basierend auf den Darstellungen der Staatsanwaltschaft und eigenen Recherchen der Tageszeitung – die Problematik in Bezug auf die erhaltenen Spenden dargelegt. Der Rest sind Nebulositäten über mögliche Folgen und Eventualitäten, die aber auch als solche kenntlich gemacht sind – vor allem in Form von Adverbien wie „vermutlich“, „offenbar“ oder „möglicherweise“ sowie mit Hilfe von „sollte“ oder „könnte“, also dem Konjunktiv II, der schon seit frühen Schulzeiten auf einer irrealen Welt basiert, ergo einem Reich mit Phantasien, Wünschen und Träumen entspricht. Und nichts anderes ist diese Berichterstattung. Dass der Titel und Zwischenüberschriften im Präsens formuliert sind, lehrt die Journalistenschule. Mit einem vorgegriffenen Urteil hat diese Einordnung nichts zu tun. Ebenso wenig der zweite von Witting angeführte Beitrag „Panama an der Donau“ vom 1. Oktober 2016. Aufgebaut wie eine Erlebniserzählung bahnt sich dessen Verfasser langsam seinen Weg zum eigentlichen Thema – den Vorwürfen gegen Joachim Wolbergs. Hier die gleiche Stilistik: Adverbien wie „angeblich“, Adjektive wie „mutmaßlich“ oder Konjunktive wie „hätte“ hüllen die Anschuldigungen in das ein, was sie zum damaligen Zeitpunkt sind: Spekulationen. Oder um es mit den Worten von Lothar Matthäus auf den Punkt zu bringen: „Wäre, wäre Fahrradkette.“
Attention please!
Im Fall von Berichterstattungen mit reißerischen Titeln von Vernichtung zu sprechen, mag auf den ersten Blick nachvollziehbar und schlüssig erscheinen, verkennt auf den zweiten jedoch die Realität der Medienwelt, der eine Ambivalenz bestehend aus ethischen Grundsätzen auf der einen und marktwirtschaftlichen Richtlinien auf der anderen Seite zugrunde liegt. Ein Journalist agiert somit nie allein und aus freien Stücken, will er davon leben. Um es mit den Worten des Kommunikationswissenschaftlers Siegfried Weischenberg zu sagen: „Vernunft, Freiheit, Wissen, Mündigkeit“ kollidieren mit „praktisch-pragmatischen Vorgaben und Zielen wie Reichweite, Konkurrenz, Redaktionsschluss, Professionalität und Karriere“. Sein Begriff „eingebaute Schizophrenie“ beschreibt dabei treffend das Dilemma zwischen dem, was von den Medienmachern verlangt wird und dem, was sie tatsächlich zu leisten im Stande sind. Auch Anja Wolbergs ist sich trotz aller negativen Erfahrungen gerade mit der Presse der Doppelbelastung der Journalisten bewusst, entbindet diese jedoch nicht von ihrer Sorgfaltspflicht, wie sie in einem Interview aus dem Jahr 2018 mit dem filter hervorhebt: „[…] ich weiß, dass es der Auftrag der Medien ist, zu berichten. Worüber ich schon anrege, nachzudenken, ist der Punkt, zu hinterfragen, ob man wirklich jede Story bringen muss, um Umsatz zu machen. In der Eile führt das dann oft dazu, dass nicht immer gut recherchiert wird. Gerade die Medien arbeiten oft mit Mutmaßungen, Behauptungen und Fragezeichen. Wenn man sich dann mal doch rechtfertigen muss, passiert das in einem kleinen Artikel mit ‚Das war falsch‘. Deswegen setze ich mich schon auch mit den Medien auseinander, aber nicht im Bösen. Man sollte eben aufpassen, wo eine moralische Grenze erreicht ist. Das muss jeder Journalist mit sich selber ausmachen.“
In diesem Zwiespalt liegt aber auch eine deutliche Parallele zur Krux ihres getrennt lebenden Ehemannes. Denn – um mit Goethe zu sprechen – auch in seiner Brust schlagen zwei Herzen: die des Privatmenschen und die des Politikers, der zurück ins Amt möchte. Persönliche Werte und Emotionen überschneiden sich dabei mit den Aufgaben und dem Auftreten einer Person des öffentlichen Lebens, bei der nun mal ein bloßer Verdacht den Nachrichtenwert ausmacht, da es die Regensburger schlichtweg mit Recht fordern. Das Grundproblem ist bei beiden Akteuren – einerseits Wolbergs und andererseits die Medienvertreter – gleich „schizophren“. Und auch was das Ziel angeht, differieren beide Parteien nicht sonderlich. Denn es geht vor allem um eins – um die Aufmerksamkeit der Menschen. Ohne sie werden weder Wolbergs noch die Medien gesehen, gelesen oder gehört. Ohne sie können weder Wolbergs noch die Medien ihre Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen. Ohne sie können weder Wolbergs noch die Medien ihrer Arbeit nachgehen. Das große Problem dabei: Aufmerksamkeit ist knapp.
Der Kampf um ein knappes Gut
Welch signifikante Rolle gerade der Reichweite oder Quote, die nichts anderes ist als gemessene Aufmerksamkeit, zukommt, weiß man in der Politik schon lange und im Journalismus spätestens seit Einführung des dualen Rundfunksystems Mitte der 80er Jahre. Der Konkurrenzdruck um die besten Nachrichten und damit um Rezipienten und Werbekunden verschärfte sich in dieser Zeit zunehmend. Fernsehen wurde fortan nicht mehr nur von gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Anstalten gestaltet, sondern auch von werbefinanzierten privaten Medienhäusern. Ihren Höhepunkt fand der Kampf um Aufmerksamkeit damals in einer anfänglich gewöhnlichen Geiselnahme, die durch die Medienakteure zu einem der größten Faupax in der Geschichte des Journalismus und der deutschen Historie des 20. Jahrhunderts stilisiert wurde – dem Gladbecker Geiseldrama 1988. Durch die Digitalisierung und dem World Wide Web hat sich in den vergangenen mehr als 30 Jahren die Situation auf dem Medienmarkt allerdings nochmals verschärft – vor allem im Tageszeitungsgeschäft. Neue Medien wie Smartphones oder Tablets sowie soziale Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram verstärken die Reiz- und Informationsflut, die wiederum auf eine begrenzte Kapazität von Wahrnehmung und Information aufseiten der Rezipienten trifft. Der Stadtplaner Georg Franck, der 1998 ein Buch mit dem Titel Ökonomie der Aufmerksamkeit auf den Markt brachte, bringt es in einem seiner weiteren Beiträge auf den Punkt: „Wie Geld wird Aufmerksamkeit chronisch knapp, sobald das Angebot an Verwendungsmöglichkeiten über die Möglichkeiten seiner Realisierungen hinausreicht.“
Nichts anderes macht Joachim Wolbergs, seitdem er vor Gericht steht. Auch er führt einen Kampf zum Wohl seiner „Ehre“ und der eigenen Existenz als Politiker. Auch er will gesehen, gehört und gelesen werden und setzt dabei ebenfalls – ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt – auf viel Gefühl. Nicht nur im Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung betont er, dass er keinen Plan B habe. Er erzählt vor Gericht von seinem abgebrochenen Studium, legt seine Finanzen offen, weint, wenn er von seiner Familie erzählt, und feuert zum Teil beleidigend gegen die Staatsanwaltschaft. Kurzum: Wolbergs legt einen Seelenstriptease hin. Er habe sich gerade im Verlauf des Prozesses „nackt“ gemacht, bringt es sein Anwalt auf den Punkt. Bis er „nicht einmal mehr die Unterhose“ angehabt hätte. Damit bedient der suspendierte Oberbürgermeister aber vortrefflich einen weiteren wichtigen Faktor für die Kreation von Nachrichten: Die Personalisierung. Und das auch öffentliche Interesse an einem Menschen, der im Rampenlicht steht, wenn auch nur im beschaulichen Regensburg.
Diese zweite Seite, die es – analog zu einem Journalisten – neben der Privatperson gibt und den Regeln der Politik gehorcht, kommt vor allem abseits des Gerichtssaals zum Vorschein. So etwa auf Wolbergs‘ Facebook-Seite. Auch wenn er in seinen Videobotschaften betont, dass es sich um eine private Nachricht handle, kommt in seinen Reden an „Die lieben Mitbürgerinnen und lieben Mitbürger“ der Staatsmann durch. Seine Ansprachen sind zwar nicht zur aktuellen Lage der Nation, aber immerhin zur aktuellen Lage der Situation und erinnern dabei an Reden aus dem Deutschen Bundestag. Wolbergs steht vor einem hellen Hintergrund, zu sehen bis zur Brust, blickt durch die Linse einer Kamera dem Zuschauer direkt in die Augen und gibt dabei rhetorisch geschult seine Einschätzung zum Prozess wider, kommentiert sachlich alles, was Medien, anonyme Schreiber im Netz, die Staatsanwaltschaft oder sonstige angebliche Kritiker über ihn berichten und beteuert seine Unschuld. Ab und an senkt er den Kopf, um vermutlich auf vor ihm liegende Notizen zu schauen. Wolbergs spricht den Rezipienten immer wieder direkt an, bleibt dabei aber im Gegensatz zu manchen Auftritten vor Gericht immer ruhig und sachlich, und lediglich die Wahl mancher Worte – „Ehre“, „Wehrhaftigkeit“ oder „kämpfen“ – macht deutlich, dass es für ihn in diesem Prozess um alles oder nichts geht: „Ich möchte vollumfänglich rehabilitiert werden.“
Jeweils für sich betrachtet sind die Doppelbelastungen der jeweiligen Parteien – Wolbergs auf der einen, Journalisten auf der anderen – relativ unspektakulär. Brenzlig wird es erst, wenn sie aufeinanderprallen, ins gegnerische Terrain vordringen und dabei meist nicht mehr nach Gusto des Gegenübers handeln. Wie es in einem Kampf eben üblich ist. Das Problem dabei ist nur, dass es ohne den anderen keinen Sieger, sondern nur Verlierer geben wird, da sie sich im Ringen um Aufmerksamkeit gegenseitig brauchen und voneinander abhängig sind. Emotional betrachtet entsteht dadurch eine verhängnisvolle Symbiose zwischen Rilkes Panther und Carl Spitzwegs armen Poeten. Rational gesehen ist es nichts weiter als eine nüchterne Tauschbeziehung: Wolbergs ist auf die Medien angewiesen, damit sie seine Informationen verbreiten, die Medien brauchen Wolbergs, damit sie ihre Inhalte bekommen und unterm Strich bekommen so beide das, worauf es ankommt: Aufmerksamkeit. Einzige Voraussetzung für den Kampf ist, dass sich jeder an seine Rolle und an die von Berufswegen vorgegebenen Regeln hält, was zugleich bedeutet, dass sie sich miteinander arrangieren und zumindest ein Stück weit anpassen müssen. Dann mag zwar hin und wieder auch mit scharfen Geschützen geschossen werden, gerichtet werden wird dabei jedoch keine der beiden Seite – Vorverurteilung hin oder her. Denn diese Rolle kann und wird in dieser Affäre nur eine übernehmen: Das Landgericht Regensburg. Und dieses hat seine Neutralität im Rahmen des Prozesses mehr als deutlich gemacht. Daraus lässt sich ableiten, dass es sich auch nicht von Presseberichten in seiner Entscheidung beeinflussen lassen wird. Schließlich gilt: gleiches Recht für alle.
„Recht“ ist dann auch das abschließende Stichwort in dieser verhängnisvollen Symbiose. Joachim Wolbergs verkündete in einer seiner Videobotschaften auf Facebook, das er das alles mache, um um sein Recht zu kämpfen: „So wie man das in einem Rechtsstaat darf. Auch wenn das manchen nicht gefällt.“ Und sein Anwalt sagte mit Blick auf das Verhalten und die Videobotschaften seines Mandanten, dass man es vielleicht nicht so machen müsse, er es aber verstehe, wenn man sich in die Situation von Wolbergs hineinversetze. In diesem Fall sollte dann aber auch gleiches Recht für alle gelten – und „alle“ umfasst in diesem Fall auch den mutmaßlichen Gegner der Symbiose, die Medien, die wie Wolbergs auch um ihr Recht kämpfen – um ihr Recht auf Meinungs-und Pressefreiheit. „Auch wenn das manchen nicht gefällt“, um den suspendierten Oberbürgermeister nochmals zu zitieren. Und überträgt man an dieser Stelle das Argument von Wolbergs Anwalt auf die Medienwelt, lässt sich auch im Hinblick auf die Texte mancher Journalisten konstatieren: Man muss es nicht so machen, aber man kann es zumindest verstehen. Denn auch außerhalb des Gerichtsaals 104 im Regensburger Landgericht gilt: gleiches Recht für alle.