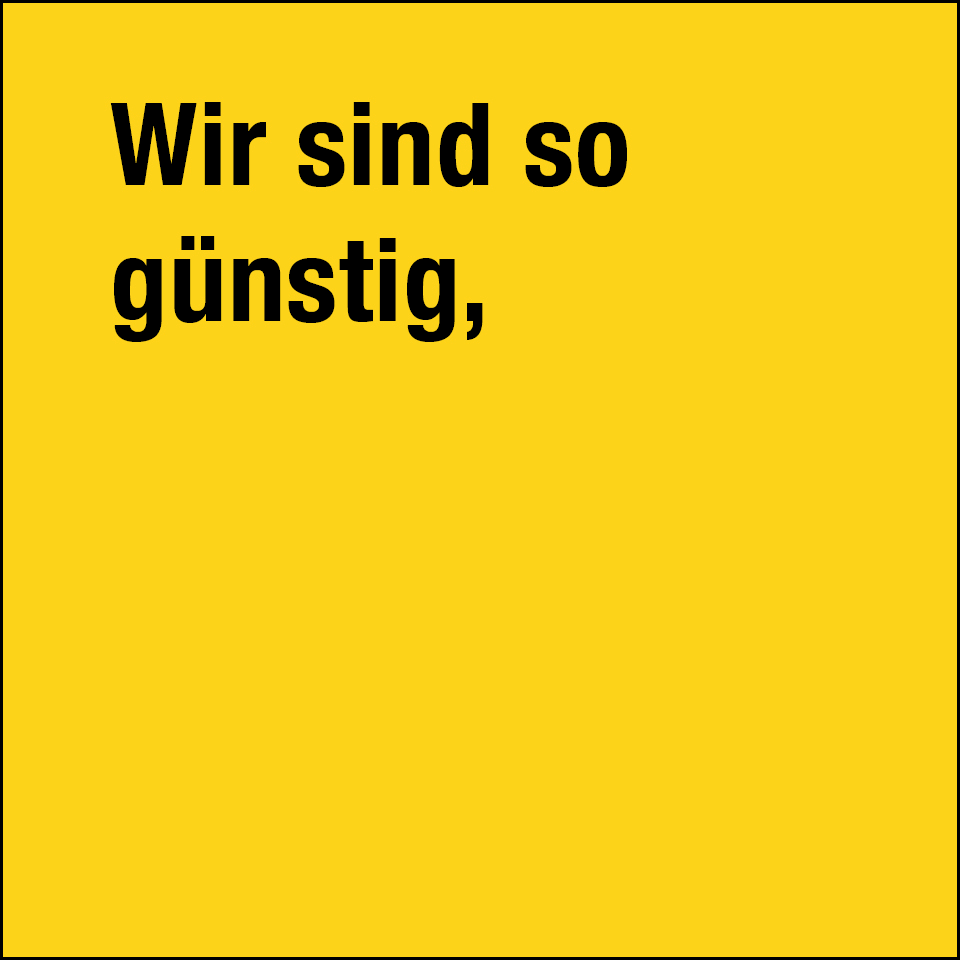Es war einmal ein Junge, der von einem Mädchen träumte – davon träumte, sie zu treffen, sie zu küssen. Doch es gab ein scheinbar unüberwindbares Hindernis, durch das sein Traum zu platzen drohte: eine knapp 1.400 Kilometer lange Grenze zwischen seinem und ihrem Land, gesichert mit Stacheldrahtzaun, Minen und Selbstschussanlagen. Erschwerend kam hinzu, dass das Mädchen von den Wünschen des Jungen keinen blassen Schimmer und an seinem Land keinerlei Interesse hatte. So ausweglos die Situation zunächst auch schien, sie hatte für den Jungen und sein Traummädchen trotzdem ein Happy End. Doch von vorne.
Das Märchen beginnt mit einer Lüge. „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“, verkündete Walter Ulbricht, damaliger DDR-Staats- und Parteichef am 15. Juni 1961 auf einer Pressekonferenz. Nur knapp acht Wochen später, am 13. August 1961, riegelten Volkspolitzisten die Grenzen zum sowjetischen Sektor ab, und mitten in Berlin wurde das Straßenpflaster aufgerissen – der Bau an der Berliner Mauer begann und zementierte Jahrzehnte lang die Teilung Deutschlands entlang der heutigen Hauptstadt. Der Kampf des SED-Regimes gegen die Republikflucht startete aber bereits 1952: Uniformierte zogen Zäune in den Himmel, die Grenze wurde abgeriegelt. Und das mehr als tausend Kilometer lang, genauer: 1.393 Kilometer. „Es war wirklich ein riesengroßes Gefängnis“, erinnert sich Steffen Berger, gebürtiger Leipziger und mittlerweile Optiker in Regensburg. Ihm zu entkommen, eine Unmöglichkeit. Der Grenzbereich war unüberwindbar. Schon 20 Kilometer vor der Grenze hielten Polizisten nach potentiellen Flüchtigen Ausschau, in der fünf Kilometer breiten Sperrzone wurde jeder kontrolliert, erzählt Steffen. Unmittelbar vor dem Zaun war dann aber endgültig Endstation: Schützen lagen mit Gewehren auf der Lauer, Landminen versteckt im Gras, Stacheldraht sicherte die Grenze nach oben hin ab. Der bloße Fluchtversuch war tödlich, daher auch der Name für den wenige Meter breiten Abschnitt entlang des Zaunes – den Todesstreifen.
Ein Schutzwall gegen die Sehnsucht nach dem grünen Gras
Genau dieses Grüne Band, wie der Todesstreifen auch genannt wird, begeht Steffen zusammen mit seiner Frau Margit im Sommer 2019. Auf Fahrrädern reist das Ehepaar rund 600 Kilometer entlang des sogenannten Iron Curtain Trails, zu Deutsch „Europa-Radweg Eiserner Vorhang“, und begibt sich dabei unmittelbar in den vor Jahrzehnten noch hochgefährlichen Sperrbereich der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Täglich legen sie im Sattel rund 100 bis 120 Kilometer in neun bis zehn Stunden zurück und stoßen dabei auf fast 40 Jahre unbetretenen Boden, wie Steffen schwärmt. Denn für viele Insekten und Pflanzen fungierte der Todestreifen als lebensrettendes Refugium. Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) waren es mehr als 1.200 seltene und gefährdete Pflanzen- und Tierarten, die im für Menschen bedrohlichen Grenzbereich ihre Schutzzone fanden und dort in nahezu unberührter Natur leben und gedeihen konnten. Im Vergleich dazu starben laut einer Studie aus dem Jahr 2017 entlang der innerdeutschen Grenze 327 Männer, Frauen und Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und 81 Jahren. Hinzu kommen 139 Todesopfer an der Berliner Mauer.Steffen selbst kam bis zum 9. November 1989 nicht mit Flucht in Berührung. Seine Eltern hingegen schon. 1972 hatten sie bereits alles dafür vorbereitet: Die beiden Ärzte hatten alle wichtigen Dokumente auf Mikrofilm abfotografiert und einen Fluchtweg organisiert. Zwischen Kofferraum und Rücksitz eines alten Mercedes war genau so viel Platz, um zwei erwachsene Personen binnen vier Stunden über die Grenze zu schmuggeln. Dann kam aber doch alles anders: „Die Tatsache, dass Mama mit mir schwanger wurde, hat dazu geführt, dass sie diesen Fluchtplan komplett verworfen haben.“ Das Risiko, erwischt zu werden, in den politischen Knast zu kommen und ihren Sohn zur Zwangsadoption freigeben zu müssen, war beiden Elternteilen zu groß, sodass Anfang der 70er Jahre alle Fluchtversuche zunichte waren. Die Alternative? „Sie haben sich arrangiert“, ergänzt Steffen. Arrangiert haben sich jedoch nicht alle. Kurz vor dem Harz entdecken er und seine Frau einen Gedenkstein für einen flüchtigen Mann, der an dieser Stelle am 1. August 1973 erschossen wurde – an Steffens Geburtstag. Ähnlich wie seine Eltern im Jahr zuvor unternahm der Mann zusammen mit seiner Frau einen Fluchtversuch, schaffte es allerdings nur bis 150 Meter vor den Zaun, wo er schließlich erschossen wurde. Seine Frau wurde festgenommen. „Da bekomme ich heute immer noch Gänsehaut“, kommentiert Steffen.
Den Todesstreifen und den Grenzbereich kannte Steffen bis zu seinem 16. Lebensjahr nur von Erzählungen. An der Grenze sei es immer taghell, aufgrund der Flutlichter auch in der Nacht, berichtete ihm sein Vater. Wollte man die Grenze doch mal überqueren, musste ein Elternteil als Pfand im Osten bleiben. Und dann natürlich die Betonpfosten, die binnen Sekunden quer über die ganze Straße hochhingen. „Irre, welche Barrieren da eingebaut waren“, staunt Steffen noch heute. Und dabei lag das Kontrastprogramm, das Land, in dem grenzenlose Freiheit zu herrschen schien, an manchen Ecken nur einen Katzensprung entfernt. Er selbst blickte durch den Bildschirm in den fremden und von vielen seiner Mitmenschen ersehnten Teil der Republik. Seine Eltern schauten verbotenerweise Westfernsehen – ein Konsum, der selbst Kindergartenkindern zum Verhängnis werden konnte. Von Erziehern wurden diese beispielsweise gefragt, welche Geschichte beim Sandmann am Vorabend erzählt wurde. Aufgrund der unterschiedlichen Sandmänner verriet allein die Antwort, welcher Sender zu Hause lief. Anderer Test: Welche Uhr kommt vor den Nachrichten? Die Ost-Uhr hatte als Minutenanzeige runde Punkte, die West-Uhr hingegen Striche. Von seinen Eltern wurde ihm deshalb von klein auf eingetrichtert, bloß nicht über das Westfernsehen zu reden.
Der Wunsch, den Westen in all seiner bunten Vielfalt kennenzulernen, wuchs bei Steffen aber nicht allein durch die schillernden Bilder aus dem Flimmerkasten. Ein Paket zu Weihnachten von seinen Verwandten auf der anderen Seite des Zaunes reichte bereits, um die Sehnsucht zu wecken. Gebannt saß die ganze Familie um die Post aus dem Westen. Meist befanden sich darin nur eine Packung Gummibärchen, Kaffee oder aufgetragene Klamotten der Westkinder. Die Freude darüber war jedoch riesig. Allein die Marken-Kleidungsstücke wie eine Levis-Jeans wurden wie „Heiligtümer“ behandelt und noch zwei Generationen weitergetragen. Hinzu kam der Duft: „Den Geruch, als man das West-Paket öffnete, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ganz selten habe ich es noch, dass etwas wie ein West-Paket riecht“, sagt Steffen mit strahlenden Augen und einem Lächeln im Gesicht.
Für ihn und seine Familie war es aber nicht allein der Geruch, der den Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland deutlich machte. Auch die Farben seien anders gewesen. Seine Eltern hatten ihm damals immer gesagt: „Pass auf, im Westen ist sogar das Gras grüner. Und so war es wirklich. Die Häuser waren weißer, das Gras war grüner. Ich habe in Bremen das erste Mal in meinem Leben eine bunte Tankstelle gesehen. Bunt beleuchtet. Das war für mich alles neu. Zigarettenautomat? Kannte ich nicht.“ Erinnerungen, die ihn auch am Todesstreifen einholen. Selbst 30 Jahre nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung erkenne man noch immer deutlich, was Ost und was West ist. „Wenn du mit dem Fahrrad durch die einzelnen Orte fährst, siehst du die Grenze immer noch, auch wenn sie gar nicht mehr existiert – an den Häusern, an den Zäunen. Man merkt es teilweise sogar an den Menschen“, erzählt Steffen. So seien beispielsweise an der Grenze von Bayern und Thüringen die Leute aus dem Osten freundlicher gewesen– im Gegensatz zu den Menschen im Westen. „Das ist mir richtig aufgefallen.“ Mit einer größeren Aufgeschlossenheit der Menschen aus dem Osten hänge dieser augenfällige Unterschied am Grünen Band seiner Meinung nach aber nicht zusammen, was ein weiteres Beispiel belegt. Ein Mann aus dem Osten habe sie auf ihrer Reise „am ausgestreckten Arm verhungern lassen“, als sie ihn nach dem Weg fragten. Als Grund vermutet Steffen dessen leichte Abneigung gegenüber Wessis.
Es ist nicht alles schlecht, was nicht glänzt
Wessis, Ossis – ein Zwist, der 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch genauso aktuell zu sein scheint wie unmittelbar danach. Mit Vorurteilen hatte auch Steffen zu kämpfen, nachdem er zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder in den Westen übergesiedelt war. Doch der Reihe nach. Am Donnerstag, 9. November 1989 überschlagen sich die Ereignisse. Der Erste Sekretär der SED-Bezirksleitung von Ost-Berlin, Günter Schabowski, bringt auf einer Pressekonferenz stammelnd den Stein ins Rollen: „Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnissen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.“ Auf die Nachfrage eines Journalisten, ab wann dies gelte, antwortet Schabowski etwas verwirrt und planlos zwischen den Blättern suchend: „Das tritt nach meiner Kenntnis… ist das sofort… unverzüglich.“ Um 22.40 erklärt das deutsche Fernsehen in den Tagesthemen die Mauer für Geschichte: „Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen“, berichtet der Moderator. Die Meldung von der Grenzöffnung der DDR geht weltweit über den Äther, die ganze Nacht hindurch flimmern jubelnde Menschenmassen über die Bildschirme, tanzend auf der 155 Kilometer langen Mauer aus Beton, bis man sie schließlich zu Fuß oder mit dem Trabant gen Westen stürmen sieht. In all dem Tumult sitzt der damals 16-jährige Steffen in Leipzig zusammen mit seinen Eltern vor dem Bildschirm und verfolgt gebannt das schier Unfassbare. Nur einen Tag später ziert seinen Pass ein Ausreisestempel mit dem Datum vom 10. November 1989. Kurz darauf sitzt er zusammen mit Vater, Mutter und Bruder im Auto auf den Weg nach Bremen.
Der Grund für die Reise in genau diese West-Stadt im hohen Norden war simpel: Es lebten dort die meisten Verwandten, und die Chance, unangekündigt jemanden anzutreffen, war dort schlicht am größten. So absurd dieser kurze Wochenendtrip der Familie noch wenige Tage vor dem historischen 9. November 1989 war, so unwirklich wirkte auf Steffen die Situation an der viel diskutierten und tödlichen Grenze. Von der lächelnden Dame am Übergang in den feindlichen Westen erhielt er ohne Zögern und als wäre es das Normalste der Welt jenen Stempel, der „so brutal viel Leid verursacht“ hat, erinnert sich Steffen nachdenklich. Zurück im Osten dauerte es noch knapp zwei Jahre, bis die Familie schließlich komplett in den Westen zog, nach Marburg in Hessen. Dort hat Steffen seine Ausbildung zum Optiker erfolgreich abgeschlossen, trotz einiger Ressentiments gegenüber seiner Herkunft: „Berger, du Ossi, dich lass ich durch die Prüfung fallen“, drohte ihm ein Lehrer an der Berufsschule in Kassel. Auch wenn es öfters mal heikle Situationen zwischen Ossis und Wessis gegeben habe, so habe er gesellschaftlich immer auch die andere Seite schätzen und kennengelernt – analog zu den beiden verschiedenen Wirtschaftssystemen. Denn obgleich im Westen ein funktionierendes System existierte, es um Fortschrittlichkeit ging und im Gegensatz zum Tauschhandel im Osten Waren im Überfluss vorhanden waren, ist er dennoch froh, im Osten aufgewachsen zu sein und die dortigen Werte wie Familie, Gemeinschaft und Zusammenhalt mit auf den Lebensweg bekommen zu haben.
Genau dieser Lebensweg hat ihn vor 20 Jahren in die Welterbestadt Regensburg verschlagen, wo er schließlich seine Frau Margit – ursprünglich aus Amberg – kennen- und lieben gelernt hat. Jenes Mädchen, von dem er bereits als Jugendlicher unbekannterweise geträumt hatte. „Ich würde gerne mal ein Mädchen aus dem Westen küssen“, fasst Steffen seine Gedanken vor dreißig Jahren zusammen. Diese Unmöglichkeit wurde für ihn mittlerweile zur Realität und brachte überdies noch zwei Söhne hervor – eine weitere Absurdität, die ohne den 9. November nicht zur Realität geworden wäre: „Unsere Konstellation würde es so nicht geben, wäre die Mauer vor 30 Jahren nicht gefallen“, stellt Steffen fest. Zumal Margit als Jugendliche keinerlei Verbindung zum abgetrennten deutschen Nachbarland hatte. Ganz im Gegenteil. Sie hat sogar eine beklemmende Situation erlebt, als sie mit der Klasse nach Berlin gefahren ist. Wie all die anderen Wessis fühlte auch sie sich auf der Transitstrecke nach Berlin unwohl. Außerdem traute sich keiner aus ihrer Klasse, auch nur einen Ton zu sagen. Die Angst, dass ihnen dann etwas passieren könnte, war zu groß. Umso glücklicher ist Steffen heute über den kleinen Fehler Schabowskis, mit dem er die Lüge von Walter Ulbricht ein Stück weit wieder wettgemacht hat: „Es ist gar nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er sich nicht versprochen hätte oder die Leute mit ihren Montagsdemos nicht so erfolgreich gewesen wären“, sagt Steffen Jahrzehnte später noch immer kopfschüttelnd.
Leicht ungläubig erzählt er auch von der schier unglaublichen Wendezeit. Denn als feststand, dass die Zeit des SED-Regimes tatsächlich abgelaufen war, herrschte „Narrenfreiheit im Osten“, bis das System wieder neu strukturiert war. Keiner hatte wirklich mehr Angst vor der Stasi, Polizei und Armee waren völlig verunsichert und mussten sich neu ausrichten. Steffen hat diese neu gewonnene Freiheit vor allem mit seinem Roller ausgelebt: „Es war einfach cool“, schmunzelt er. Nachts seien sie sogar mal in ein Schwimmbad eingebrochen – ohne Folgen. Wesentlich heikler ging es jedoch vor der Wende auf den Montagsdemonstrationen zu. Bei einer gab es auch einen Schießbefehl, erinnert sich Steffen: „Zum Glück war jemand so besonnen, den Schießbefehl nicht umzusetzen. Sie hätten mit ihrer scharfen Munition ein Massaker anrichten können.“ Es war jener Tag, an dem Polizisten aus Dresden nach Leipzig gekommen waren, damit sie im Zweifelsfall nicht auf ihre eigenen Bekannten schießen müssen. „So dramatisch war das“, erzählt Steffen noch immer sichtlich schockiert. Im Sommer 1989, kurz vor dem Fall der Mauer, besuchte Steffen zusammen mit seinen Freunden erstmals eine Montagsdemo in Leipzig – trotz des Verbotes seiner Eltern. Wie gefährlich die Teilnahme und das Tanzen vor Wasserwerfern waren, realisierte er erst später. „Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, wie von Stasi durchsetzt dieser Staat war.“ Als herauskam, dass er und seine Freunde dort waren, wurden sie von der Stasi auch schon beobachtet und bekamen Stress mit der Schule. Dieser löste sich glücklicherweise in Wohlwollen auf, da der Staat eh schon am Zersetzen war. „Es hätte aber auch ganz anders ausgehen können“, weiß Steffen.
Das Märchen, das mit einer Lüge anfing, hätte tatsächlich ganz anders ausgehen können. Tut es aber nicht. Der Eiserne Vorhang zerfiel von November ‘89 an immer mehr, das Ende des Kalten Krieges rückte immer näher und die Staaten unter dem Einflussbereich der zusammenbrechenden Sowjetunion wurden selbstständig. Knapp 30 Jahre danach steht Steffen zusammen mit seinem Mädchen aus Westdeutschland Arm in Arm am zweithöchsten Berg der DDR, dem Brocken. Niemals hätte er gedacht, dass er einmal ein Mädchen aus dem Westen „knutschen“ würde – zu einschüchternd und zu „scharf“ war die innerdeutsche Grenze. Dennoch haben sie auf ihrer Reise alle Berge erklommen, was danach folgt, ist flaches Land – das Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann küssen sie noch heute.