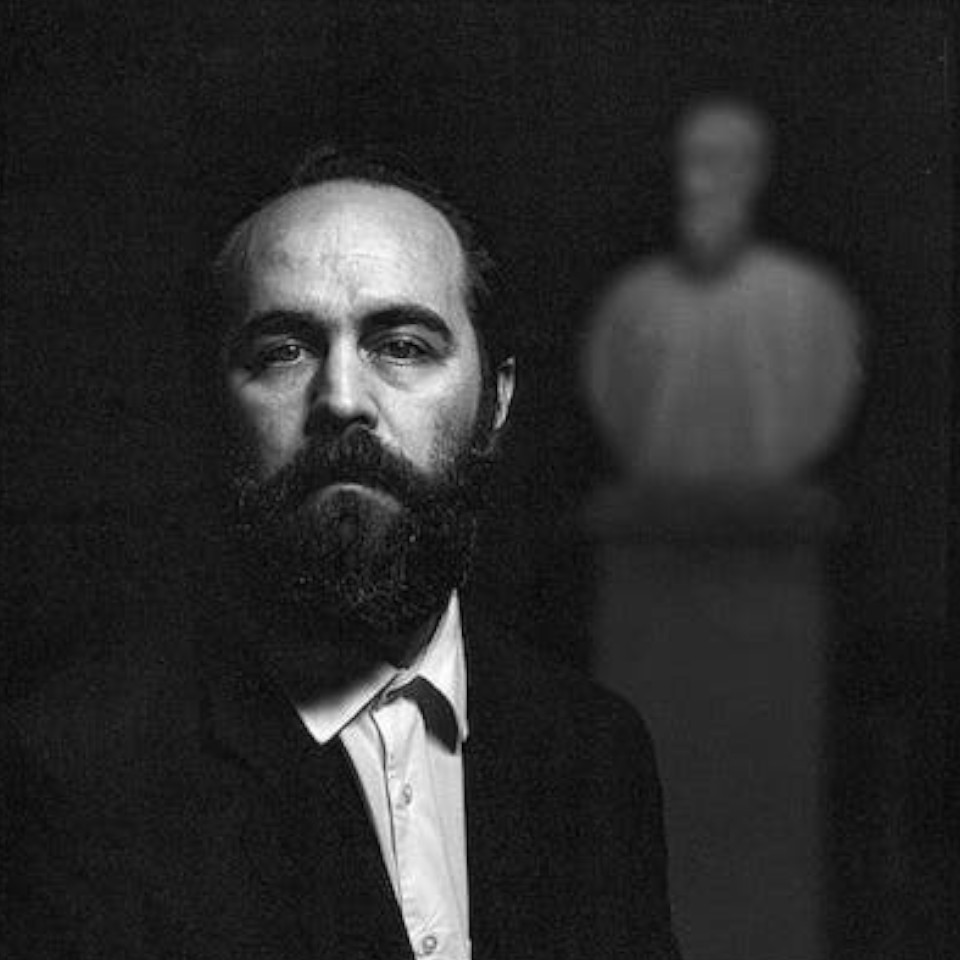Tetrahydrocannabinol ist eine Substanz, die in Pflanzen der Gattung Hanf (Cannabis) vorkommt. Ihr werden nicht nur eine berauschende Wirkung, sondern in den letzten Jahren auch vor allem bei schwerstkranken Menschen alltagsverbessernde und schmerzlindernde Effekte zugesprochen. Es gibt zahlreiche Kranke, die durch ein ordentliches Therapie-Regime mit Cannabis profitieren. Dennoch ist die Verordnung nicht so einfach und so universell sinnvoll, wie viele es sich wünschen würden.
Seit Einführung hagelt es nicht nur bei mir Anfragen bezüglich der Verordnung bei bestimmten Krankheitsbildern von Akne bis hin zum Fersensporn. Dies sind natürlich keine Gründe für eine Verordnung von Cannabis auf Rezept und werfen ein eher zwiespältiges Licht auf den vermeintlichen Interessenten, der sich vermutlich nicht ordentlich informiert hat und es „einfach mal probiert“. Dabei ist die Sachlage, wem medizinisch verordnetes Cannabis zusteht und wem nicht, gar nicht so leicht zu durchschauen: Eine feste Indikation gibt es laut Gesetzgebung vom März 2017 bis heute eigentlich nicht. Dennoch erteilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte für Patienten mit mehr als 50 verschiedenen Erkrankungen eine Genehmigung für eine sog. „begleitete Selbsttherapie mit Medizinal-Cannabis“ beim schwerstkranken Patienten. Zumindest wurde somit eines festgelegt: Cannabinoide sollten nicht als einzelnes Therapeutikum, sondern nur und ausschließlich zu einer bestehenden Medikation zusätzlich verordnet werden.
Dann wird es schon schwammiger: Ein Heilversuch unter Zugabe von Cannabinoiden ist laut § 31 Abs. 6 SGB V dann indiziert, wenn eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt. Außerdem muss eine dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung stehen, diese mangelhaft wirksam sein oder nicht vertragen werden. Bei der Fülle an Medikamenten, die bei der Behandlung schwerstkranker Personen zur Verfügung steht, wird der erfahrene Mediziner wohl selten an diese Grenzen stoßen. Zuletzt sollte eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome bestehen. Nun ja, aus anderen Gründen sollten herkömmliche Medikamente auch nicht verordnet werden. Oder würden Sie jemanden Augentropfen verschreiben, wenn er mit Rückenschmerzen ankommt?
- Extremes Untergewicht|Kachexie|Appetitlosigkeit, vor allem bei HIV
- Chronischer Schmerz · Tumorschmerz · Nichttumorbedingter Schmerz
- Neuropathischer, also aufgrund einer Nervenschädigung/-fehlfunktion resultierender Schmerz
- Schlafstörungen bei chronischem Schmerz
- Viszeraler Schmerz, also Schmerz im Bauch- oder Beckenbereich
- rheumatologisch ausgelöster Schmerz, Muskelschmerz und Fibromyalgie
- Spastik bei Multipler Sklerose (MS) und schmerzhafte Spastik, also eine schmerzhafte, steife Lähmung der Gelenke
- Chemotherapie-bedingte Übelkeit und Erbrechen
- Tourette-Syndrom 51
Zumindest bei einer bestimmten Gruppe von Krankheiten ist es derzeit nicht angebracht, Cannabinoide zu verordnen: zum Beispiel neuropsychatrische Erkrankungen. Das dürfte nicht verwundern, da THC eben solche Krankheiten bekannterweise auslösen kann und dies auch häufig tut. Trotz positiver Erfahrungen auf der Grundlage von Einzelfallberichten wird derzeit keine Empfehlung ausgesprochen für weitere Krankheiten u.a. Morbus Parkinson, ADHS oder Kopfschmerz. Grund dafür ist, dass es für diese Krankheitsarten aktuell „keine oder nur eine zu dürftige Studienlage“ gibt.
Die Verordnung stellt bis heute noch keine Regelleistung dar. Es besteht ein „Erstattungsvorbehalt“. Die Genehmigung der Kosten bei Erfüllung der geforderten Kriterien erfolgt nach bestimmten Prüfungszeitfenstern, die je nach Dringlichkeit zwischen drei Tagen im Palliativ-Fall bis hin zu fünf Wochen im Normalfall variiert. Die Verordnung erfolgt über ein sog. BtM-Rezept. Grundsätzlich ist auch eine Privatverordnung möglich, wenn die Krankenkassen die Kostenerstattung nicht übernehmen.
Die Schwere der Erkrankung und eine evtl. Unverträglichkeit bezüglich der Standardtherapie muss im Einzelfallantrag zwingend dargelegt werden. Außerdem muss sie „endständigen Krankheitszuständen im internistischen oder neurologischen Bereich entsprechen, bei denen eine Heilung nicht mehr möglich ist“. Ziel ist dabei eine spürbar positive Auswirkung auf den Krankheitsverlauf oder eine Symptomkontrolle. Der positive Effekt ist bei Gabe als Add-On-Therapeutikum, also als Dreingabe zur bestehenden Medikation, nicht immer unbedingt abgrenzbar oder eindrücklich zu messen. Darüber hinaus wichtig für den Therapeuten: Der verordnete Verbrauch ist dabei stets vom „Freizeitgebrauch“ abzugrenzen. Aber wer prüft denn das und wie?
Die Zieldosis ist ebenso wie die Einnahmefrequenz „patientenindividuell“ und sollte langsam aufdosiert werden. Meist ist die Dosierung über 2-3 Gaben im Tagesverlauf, zur Linderung nächtlicher Beschwerden eher abends sinnvoll. Es kam in Studien im Rahmen der medizinischen Anwendung von Cannabis kaum zu Entzugssymptomen. Bei einer Dauerverordnung wird die therapeutische Dosierung an die Beschwerden angepasst. Was die positiven Ergebnisse im Rahmen bestimmter Krankheitsbilder betrifft, sind die Cannabinoide im Übrigen nicht zu unterschätzen.
So lange jedoch keine klaren Indikationen für einen sinnvollen Einsatz beim richtigen Patienten bestehen, halte ich mich (womöglich ähnlich wie zahlreiche Kollegen) zurück und überlasse die Verordnung den Fachleuten, sprich Neurologen, Schmerztherapeuten und Palliativmedizinern. Somit bleibt medizinisch verordnetes Cannabis eine Zusatzleistung, die man erbringen kann, aber nicht muss, die einen im Vergleich zu bewährten Medikamenten hohen bürokratischen Aufwand bedeutet und die z.T. mit hohen Behandlungskosten verbunden ist. Schwerkranke Menschen können dennoch von dieser Reform und den positiven Effekten des „Wunderdroge“ profitieren und Trittbrettfahrer werden es so weiter schwer haben sich unberechtigterweise ihr „High“ von der Kasse finanzieren zu lassen. Neue Erkenntnisse, wem durch Einsatz von THC noch geholfen werden könnte, lassen sich so aber auch nur schwer gewinnen. Es bleibt ein zweischneidiges Schwert und die beste Medizin am Ende immer noch die, die man nicht braucht.
Ein Gastbeitrag von Dr. Heinz Lehmann
Quelle:
https://dgs-praxisleitlinien.de/application/files/5815/5445/5600/PLL_Cann_web_kl.pdf