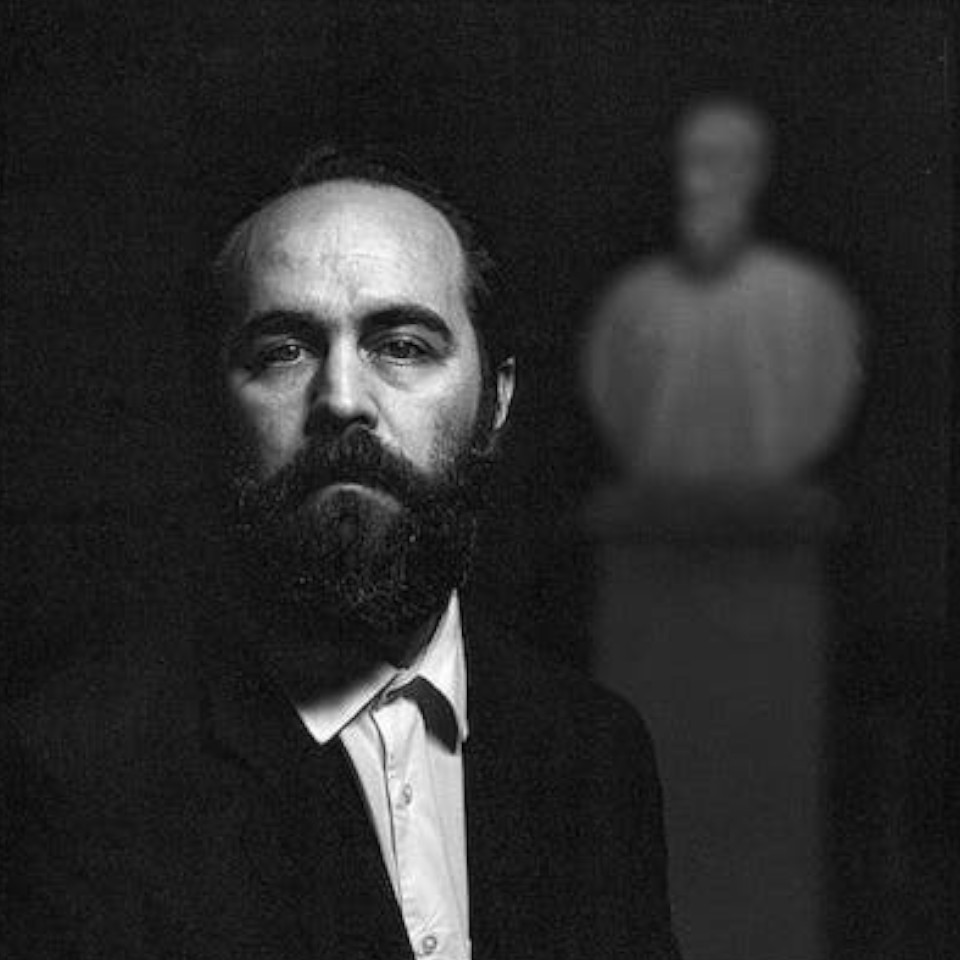Ab 2020 soll es auch bei uns zur Verfügung stehen, bis 2025 will die Deutsche Telekom 99 Prozent der Haushalte damit versorgen – die Rede ist vom neuen Mobilfunknetzwerk 5G. Nutzer und Industrie freuen sich auf die neue fünfte Generation des Mobilfunkstandards, verspricht sie doch Datenübertragung in Echtzeit und die Entwicklung innovativer Dienste wie Industrie 4.0 oder automatisiertes Fahren. Auch wenn die technologischen Wünsche im Zusammenhang mit 5G vielversprechend klingen, ist das neue Mobilfunknetzwerk bislang aber vor allem eins: eine hypothesenumwobene Unbekannte, deren Folgen gerade für die menschliche Gesundheit noch immer undurchsichtig sind.
Mitte dieses Jahres endete die längste Frequenzauktion, die Deutschland je erlebt hat. Das Resultat kann sich sehen lassen, vor allem für den Bund. Mit der Versteigerung der 5G-Frequenzblöcke nahm er mehr als 6,5 Milliarden Euro ein – nach Angaben der Bundesnetzagentur waren es exakt 6.549.651.000 Euro und damit deutlich mehr als die von Experten prognostizierten drei bis fünf Milliarden Euro. Genutzt werden sollen die Einnahmen unter anderem auch zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. Zur Auktion, die am 19. März 2019 startete und am 12. Juni 2019 nach zwölf Wochen und sage und schreibe 497 Runden endete, waren vier Unternehmen zugelassen: Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch. Mit 2,17 Milliarden Euro ließ sich die Deutsche Telekom ihre 5G-Frequenzen am meisten kosten, dahinter folgen Vodafone mit 1,88 Milliarden Euro und Telefónica mit 1,42 Milliarden Euro. Neueinsteiger Drillisch blätterte immerhin noch 1,07 Milliarden Euro auf den Tisch. Am Ende der Versteigerung sprach Jochen Homann, Chef der Bundesnetzagentur, von einem „Startschuss für 5G in Deutschland“.
Ob der Schuss sein Ziel erreichen oder doch eher verfehlen wird, ist bislang aber völlig unklar. Werden sich die milliardenschweren Investitionen überhaupt jemals rentieren? Die Antwort bleibt Zukunftsmusik. Fest steht jedoch, dass das Megaprojekt 5G die informationstechnische Revolution in eine neue Sphäre heben soll: tausendmal mehr Datenvolumen soll übertragen werden, die Signalverzögerung soll sich auf eine Millisekunde reduzieren – eine Reaktionszeit, die vom Menschen nicht mehr wahrgenommen werden kann –, Autos sollen in Echtzeit kommunizieren, Kühlschränke mitdenken und Fabriken mit Robotern betrieben werden. Kurzum: Bei 5G geht es nicht allein um das Telefonieren und um die reibungslose Internetznutzung durch den privaten Endverbraucher, es geht vor allem auch um das Internet of Things (IoT), zu Deutsch: das Internet der Dinge. Dabei drängt sich allerdings eine weitere Frage auf: Wie lassen sich höhere Datenraten und Kommunikation in Echtzeit überhaupt erreichen?
Strahlung ist nicht gleich Strahlung
Auch bei 5G kommt elektromagnetische Strahlung zum Einsatz, genauso wie bei allen anderen Mobilfunknetzwerken oder der Mikrowelle. Im Gegensatz zur Röntgenstrahlung oder Radioaktivität ist diese hochfrequente Strahlung jedoch nichtionisierend und reicht von 0 bis 1.500 Terahertz (THz). Strahlung oberhalb von 1.500 THz wird als ionisierend bezeichnet und besitzt so viel Energie, um Moleküle auseinanderzureißen oder Zellen mutieren zu lassen, wodurch Erbgut beschädigt werden kann. Die elektromagnetischen Felder von Haushaltsgeräten, Rundfunkwellen oder Mobilfunk liegen allerdings alle im nichtionisierenden Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Trotz teils netzweiter Panikmache können Tschernobyl- oder Fukushima-Katastrophen bei 5G also schon mal ausgeschlossen werden, was die Bedenken gegenüber dem neuen Mobilfunknetzwerk jedoch nicht schmälert. Denn auch Mobilfunkstrahlung bringt Wassermoleküle zum Schwingen, wodurch Reibungswärme erzeugt wird, die wiederum die Temperatur in Gewebe und Zellen steigen lässt.
Strahlung dringt in den Körper immer dann ein, wenn das Handy sendet oder empfängt – wie tief, bestimmt die Frequenz: Je niedriger ihr Wert, desto tiefer dringen die Strahlen ein. Bei der neuen 5G-Technik wird im Gegensatz zu 2G, 3G oder 4G mit sehr hohen Frequenzen gearbeitet, die nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in weiteren Ausbauschritten bis in den Milli- oder Zentimeterwellenbereich vordringen sollen, etwa im 26 Gigahertz- (GHz) oder 40 GHz-Band. Für diesen Bereich sieht jedoch auch das BfS „Forschungsbedarf“. Zwar erwartet es bei diesen sehr hohen Frequenzwerten unterhalb der bestehenden Grenzwerte ebenfalls keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen, konstatiert in diesem Zusammenhang aber auch gleichzeitig die geringe Anzahl an Untersuchungsergebnissen. Der Grenzwert für elektromagnetische Strahlung ergibt sich dabei aus dem thermischen Effekt. Aus einer bestimmten Entfernung dürfen ein Handy oder ein Smartphone Körpergewebe um maximal ein Grad Celsius erwärmen, was selten vorkommt. Gefahr bestehe laut BfS außerdem allenfalls für Haut und Augen, da hochfrequentierte elektromagnetische Felder im Milli- oder Zentimeterwellenbereich nahe der Körperoberfläche absorbiert würden. Mit Folgen für innere Organe rechnet es nicht, aber auch das: ohne Gewähr.
Die Bundesnetzagentur hat bislang die Frequenzen in den Bereichen von 3,4 GHz bis 3,7 GHz an die vier Unternehmen versteigert. Und schon allein für diese Bereiche ergeben sich einige Probleme, da die Reichweite bei höheren Frequenzen abnimmt und sich diese beispielsweise schlecht durch Mauern übertragen lassen. Folglich werden viel mehr Sendemasten innerhalb eines bestimmten Gebietes benötigt als für andere Mobilfunknetzwerke. Zudem lassen sich die neuen Sendestationen in Form kleinerer Kästen auch an Laternen, Bushaltestellen oder Wänden befestigen. Selbst wenn diese sogenannten Kleinzellen eine geringere Sendeleistung haben, kommen Menschen der erhöhten elektromagnetischen Strahlung dennoch näher als bisher, woraus sich eine weitere Frage ergibt: Welche Auswirkungen ergeben sich daraus für die eigene Gesundheit? Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr und beziehen sich meist auf Forschungen zur Wirkung bisheriger Mobilfunknetze. Während einige Wissenschaftler betonen, dass sich ihre Studien zu den alten Frequenzen nicht auf das neue 5G-Netz übertragen lassen, handhabt die ‚Lobbyisten-Seite‘ das Thema mit Beschwichtigung und dem Von-sich-Schieben der Verantwortung: Vodafone folgt beim Thema Krebs der Einschätzung der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), wonach Mobilfunkwellen „möglicherweise krebserregend“ sind. Beim Thema Unfruchtbarkeit, Bienensterben oder der Irritation für Vögel und Fledermäuse verweist der Anbieter auf das BfS, demzufolge unterhalb der Grenzwerte Mensch, Tier und Natur nicht gefährdet sind. Die Stopp-Forderung des 5G-Ausbaus vonseiten besorgter Wissenschaftler, Ärzte oder Strahlen-Kritiker kontert die Deutsche Telekom mit ihrer Aufgabe, den von Politik, Medien und Öffentlichkeit geforderten 5G-Ausbau zügig vorantreiben zu müssen. Und das BfS blendet 5G erstmal aus und windet sich stattdessen in „wissenschaftlichen Unsicherheiten“ zur generellen Langzeitwirkung intensiver Handynutzung. Um es mit einem bayerischen Sprichwort auf den Punkt zu bringen: Nix Gwiss woas ma ned.
Probanden vor!
Etwas mehr weiß man derzeit lediglich über die Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung auf Ratten und Mäusen. Erkenntnisse darüber gibt etwa eine Studie aus dem Jahr 2018 des National Toxicology Programm (NTP), einem Forschungsprogramm des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, die einen Zusammenhang zwischen sehr hochfrequenter Strahlung bestehender Mobilfunkstandards und Krebs sieht. Für ihre Studie haben die US-Wissenschaftler Mäuse und Ratten elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt – über zwei Jahre hinweg, für neun Stunden täglich. Das Ergebnis: Bei männlichen Ratten kam es – im Gegensatz zu ihren nicht bestrahlten Artgenossen – zu einer Entwicklung von Tumoren am Herzen.
Die Übertragung der Tests auf den Menschen ist jedoch auch in diesem Tierversuchsfall zweifelhaft, da sich bei einem Menschen die Strahlung nicht wie bei den Ratten auf den ganzen Körper konzentriert, sondern nur auf die Körperregionen, an denen sich gerade das Handy befindet. Zudem lag der Bestrahlungswert höher als in Deutschland erlaubt. Und nicht zuletzt ist die Bestrahlungsdauer von neun Stunden täglich für viele Menschen nicht real. Ähnlich schräg verhält es sich mit Tests zur Wirkung von Handystrahlung, bei denen eine verminderte Mobilität von Spermien oder Veränderungen des Glukose-Stoffwechsels festgestellt wurden. Die Ergebnisse sind schlicht nicht einheitlich und bleiben deshalb nebulös. Klarheit könnte wohl einzig eine randomisierte kontrollierte Studie bringen, bei der zufällig ausgewählte Probanden über einen längeren Zeitraum hinweg verschieden starker Handystrahlung ausgesetzt würden. Bislang haben sich für solche Tests aber nur Tiere finden lassen.
Als Schutz vor elektromagnetischer Strahlung auch im 5G-Netz gelten deswegen wie bisher nur die Grenzwerte – festgelegt von der privaten und nicht unumstrittenen Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) – sowie Tipps vom BfS: Das Handy so oft wie möglich ausschalten und nicht zu nah am Körper tragen, vor dem Zubettgehen den Flugmodus aktivieren und auf den SAR-Wert des Mobilfunkgerätes achten. Hier lautet die Faustformel: Je geringer der Wert, desto geringer die Strahlung. Dies gilt jedoch auch für aktuelle Mobilfunknetzwerke. Für die fünfte Generation sind genaue Aussagen gerade im Hinblick auf mögliche Gesundheitsrisiken oder -folgen bislang bloße Spekulation, da Langzeitstudien fehlen. Bis also in einigen Jahrzehnten treffliche Ergebnisse vorliegen, bleibt 5G wohl ein Megaprojekt mit gesundheitlichem Experimentiercharakter und dem Menschen als 70 Kilogramm schwere Versuchsratte. High five, 5G!