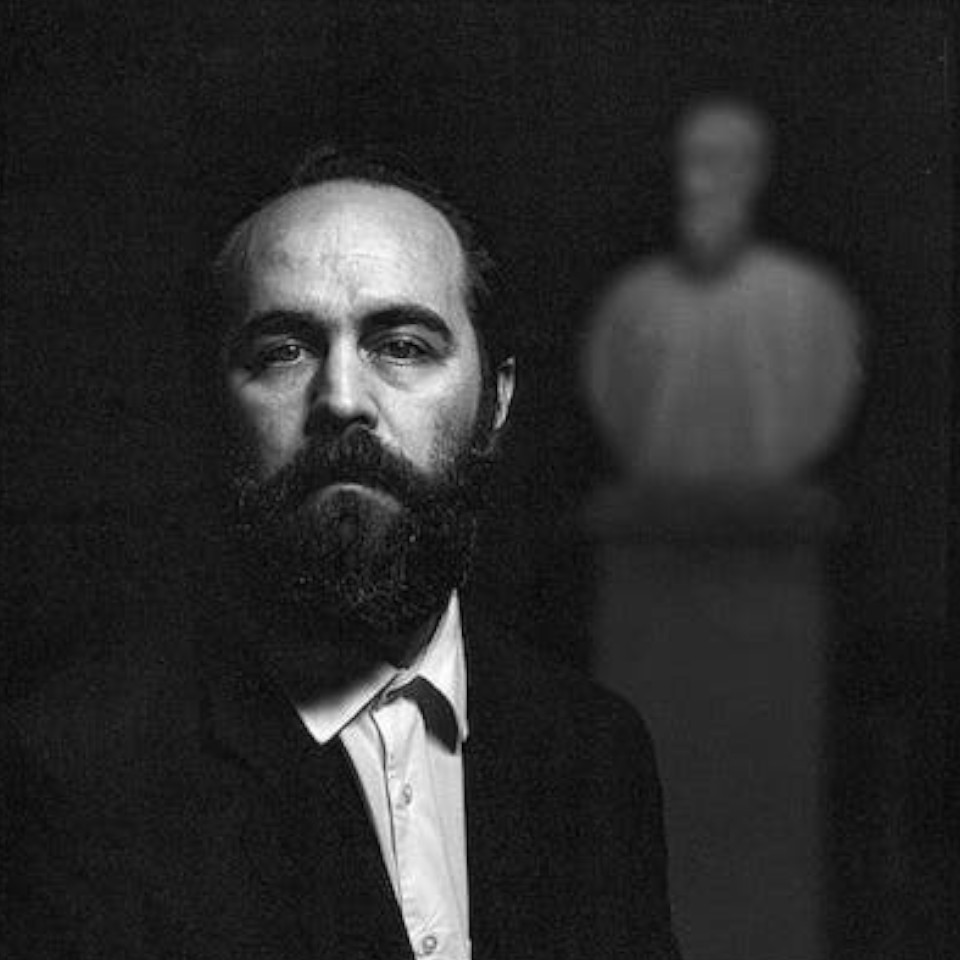Schleuderpreise, Schlachthofskandale und Schadstoffkonzentrationen in deutschen Böden werfen immer wieder unangenehme Schlaglichter auf die moderne Konsumgesellschaft. Fleischgenuss hat für viele längst einen faden Beigeschmack, manche haben ihm sogar abgeschworen. Für alle anderen bleibt die Frage: Kann man Fleisch noch guten Gewissens essen?
Preiskampf
Wer in den Sommermonaten durch die Kühltheken der Supermärkte schlendert, stößt auf zahlreiche Angebote und Preisknüller. Die Regale sind dabei nicht nur reich an Auswahl, sondern auch voller Tiefstpreise: Ein Kilogramm Bratwürste für 3,89 EUR, 550 Gramm marinierte Putensteaks für 2,99 EUR, 800 Gramm Rinder-Entrecôte für 10,20 EUR, 100 Gramm Holzfällersteak vom Schwein für 35 Cent oder ein Kilogramm Schweinenacken für 3,91 EUR stellen nur einen Auszug auffallend erschwinglicher Fleischprodukte aus Angebotsprospekten vom 27. Juli bis zum 01. August 2020 dar. Fleisch zum Schleuderpreis stellt zwar keine Seltenheit in deutschen Discount- und Supermärkten dar, scheint aber gerade zur Grillsaison als Kundenmagnet zu fungieren. Als aggressive Preisdrücker entpuppen sich dabei nicht selten die Discounter: Immerhin bildet das Prädikat „günstig“ den Markenkern des Discounts, zu Deutsch „Rabatt“, ab. Wie tief gerade Aldi – nach eigenen Aussagen „Der Erfinder von günstig“ – Willens und in der Lage ist, die Fleischpreise anzusetzen, erlebten die Deutschen im Sommer 2017 mit einem unschlagbaren Angebot von 1,99 EUR für 600 Gramm Schweinenacken. Dass bei einem Kilogrammpreis von 3,316 EUR wohl an allen Ecken und Enden gespart werden muss, war auch den Bundesbürgern bewusst, die einen regelrechten Shitstorm in den sozialen Medien veranstalteten: „Billigster Dreck“, „zum Kotzen“ und „verantwortungslos“ kommentierten Facebook-Nutzer die damalige Preispolitik von Aldi Süd.
So positiv sich der Preiskampf der Discountgiganten auf den Geldbeutel der Konsumenten auch auswirken mag, die Kosten für einen derartigen Wettbewerb tragen neben den Arbeitern des verarbeitenden Gewerbes – wie Skandale in Schlachtbetrieben wie Tönnies zeigten – vor allem die Erzeuger und deren Vieh. Ohne weitreichende Agrarsubventionen kommt die Landwirtschaft längst nicht mehr aus. Laut Greenpeace werden in der EU jährlich rund 30 Milliarden als flächenbezogene Agrarsubventionen oder zweckgebundene Förderung an Tierhalter oder Tierfutter produzierende Betriebe ausgezahlt. Wieviel davon die Bauern locker machen können, um freiwillig in Tierwohl zu investieren, bleibt fraglich, da das Geld zumeist niedrige Verbraucherpreise ausgleicht und vor allem bei Kleinbetrieben in den Erhalt des Betriebs selbst fließt. Preisdruck und ruinöse Sonderangebote beschleunigen das Bauernsterben in Deutschland – über 300.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland wurden in den letzten 20 Jahren aufgegeben oder wurden von Großkonzernen aufgekauft. Ein Trend, der auch von EU-Agrar-Subventionen nicht gebremst werden kann, da er durch die Bevorzugung von Großbetrieben den Konzentrationsprozess noch verstärkt.
Zwischen Imagepflege und Gruppenzwang
Die Bundespolitik sieht sich indes schon seit geraumer Zeit vor die Frage gestellt, wie der Spagat zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Tierwohl wohl gelingen könnte. Nicht nur im Bereich des Mastviehs gilt es, sich den problematischen Haltungsbedingungen zu stellen, denn die nicht selten überlebensnotwendige Kostenoptimierung innerhalb der Tierhaltung wirkt sich auf jegliches Nutztier aus – von den Legehennen bis zur Milchkuh. Auch die Discounter suchten lange Zeit nach einem konsensfähigen Ausgang aus dem selbst eingebrockten Image, im Kampf um Kunden das Fleisch zu Dumpingpreisen zu verkaufen. Während die Politik die Einführung eines einheitlichen Siegels seit Jahren vor sich herschiebt und sich im September 2019 nach langem Raufen endlich auf ein staatliches, aber dennoch freiwilliges Tierwohl-Label für Schweine einigen konnte, nutzte ein Verbund aus Lebensmittelhändlern die Gelegenheit, dem Staat zuvorzukommen und ein eigenes Label einzuführen.
Das im April 2019 eingeführte Label „Haltungsform“ sollte den Verbraucher nicht nur darüber aufklären, wie das geschlachtete Tier gehalten wurde und wie viel Platz es zur Verfügung hatte, sondern ihm auch die Möglichkeit bieten, sich für eine bestimmte Haltungsform zu entscheiden. Während Haltungsform 1 den Tieren die gesetzlichen Mindeststandards im Stall zuspricht, garantiert Haltungsform 4 – vereinfacht gesagt – neben diversen Benefits wie organisches Beschäftigungsmaterial und genfreies Futtermittel die doppelte Fläche samt Auslauf. Das Problem dabei: Anstelle sich wirklich für eine Bekämpfung der Missständen innerhalb der Wertschöpfungsketten auszusprechen und das eigens ins Rollen gebrachte Preisdumping zu beenden, um seinen Produzenten und Lieferanten dadurch mehr wirtschaftlichen Spielraum zuzugestehen, wälzt man die Verantwortung an die Niedrigpreis-verwöhnten Kunden ab. Dabei führte die Einführung eines Labels zur Kenntlichmachung der Haltungsform weniger zur Vergrößerung des Handlungs- oder Entscheidungsspielraums des Kunden als vielmehr zur Offenlegung verborgener, aber längst etablierter Strukturen in der Fleischproduktion. Denn wohin mehrere Jahrzehnte Preisdruck im Gewerbe führen, deckt sich unmittelbar mit der vermeintlich plötzlichen Freiheit der Verbraucher, sich beim Einkauf für bessere Haltungsformen auszusprechen. Vor wie viel Entscheidungsfreiheit die Verbraucher dank des neuen Labels tatsächlich gestellt wurden, untersuchte Greenpeace Ende 2019. Der Befund: Im Oktober 2019 lag hauptsächlich Billigfleisch in den Regalen der Anbieter. Mehr als 87 Prozent aller angebotenen und gelabelten Rinder- und Schweinefleischwaren entsprangen der Haltungsform 1: dem gesetzlichen Mindeststandard von 0,75 Quadratmeter pro Schwein und 1,5 bis 2,2 Quadratmeter pro Rind im Stall.
Während die Tierschutzstiftung Vier Pfoten erst ab der Haltungsstufe 3 Tierwohl als möglich erachtet und Greenpeace moniert, dass es sich bei der Schweinehaltung der Haltungsformen 1 und 2 laut eines Hamburger Rechtsgutachtens per se um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und somit gegen die Verfassung handle, stößt sich die Verbraucherzentrale an der Wahrnehmung des Labels „Haltungsform“ als Tierwohl-Label. Fragen wie „Passt der Betrieb auf das Verhalten oder Verhaltensstörungen seiner Tiere auf?“ oder „Reagiert der Betrieb auch schon bei kleineren Auffälligkeiten und Verletzungen der Tiere oder bei Befall mit Parasiten?“ werden durch das Label nicht beantwortet. Ebenso liefert das Label keinen Aufschluss darüber, ob die Tiere gewaltsam ihrer Haltungsform angepasst und ob zur Aufzucht der Tiere Ringelschwänze, Schnäbel oder Hörner gekürzt oder abgetrennt wurden. Ersteres ist zwar seit über 20 Jahren verboten, dennoch schätzen Experten, dass bei mehr als neun von zehn Ferkeln Teile ihres Schwanzes im Alter von nur wenigen Tagen amputiert werden. Obwohl sich Lebensmittelhändler wie Rewe, Aldi, Penny und Lidl dafür ausgesprochen haben, Fleisch der Haltungsform 1 in Zukunft aus dem Sortiment zu nehmen, muss dieser Schritt vor dem Hintergrund der Einschätzungen von Vier Pfoten und Greenpeace als Tropfen auf dem heißen Stein bewertet werden.
Tierwohl kostet
Um die Missstände in der Tierhaltung zu beseitigen, bedarf es allerdings weitaus mehr, als die Verantwortung mittels einer Entscheidungsfreiheit auf den Kunden abzustreifen. Selbst wenn Skandale um Arbeitsverhältnisse in Schlachthöfen oder das Bekanntwerden von Tierquälereien auf Bauernhöfen in den letzten Monaten dazu führen, dass neben dem Wunsch nach mehr Tierwohl in der Gesellschaft auch die Bereitschaft gestiegen ist, höhere Preise für Fleischwaren zu bezahlen, bleibt ein höherer Preis nur ein mangelhafter Indikator für Qualität und Tierwohl. Denn wer garantiert, dass das Mehr an Geld eins zu eins beim Landwirt landet und dieser letztendlich auch in mehr Tierwohl investiert? Und wie viel Geld braucht es eigentlich, um die Tierhaltung in Deutschland auf absehbare Zeit zu verbessern?
Bereits seit 2015 setzt sich der Lebensmitteleinzelhandel mit der „Initiative Tierwohl“ für eine Verbesserung der Tierhaltung in Deutschland ein. Rund 650 Millionen Euro hat er dazu in den letzten fünf Jahren investiert. Nach eigenen Angaben sollen bereits 483 Millionen Hähnchen und rund 26 Millionen Schweine von besseren Haltungsbedingungen profitiert haben. Dass dies aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann, zeigt nicht nur das Angebot von Schweinefleisch, dass zum Großteil aus der Haltungsform 1 stammt. Möchte man das Tierwohl in Deutschland ad hoc verbessern, beispielsweise durch die Streichung der Haltungsform 1, würden laut Berechnung der Borchert Kommission rund drei bis fünf Milliarden Euro Fördergelder jährlich benötigt. Dafür wäre bis 2040 auch die Anhebung des Mindeststandards innerhalb der Tierhaltung auf Haltungsform 3 mit 40 Prozent mehr Platz für die Schweine zu erreichen.
Die Frage nach dem Tierwohl fordert nach jahrzehntelangem Backen-Zusammenkneifen nun doch den Spagat in der Politik. Denn wie kann Fleisch so bepreist werden, dass es weder zum Luxusgut mutiert, noch am Tierwohlgedanken vorbeischießt? Wie kann sichergestellt werden, dass die Bauern gerecht für ihr Fleisch entlohnt werden, um anschließend in Tierwohl zu investieren? Die Borchert Kommission liefert für die Lösung schon mal einen preislichen Ansatz. Um die angepeilten Tierwohlziele mit 3,6 Milliarden pro Jahr zu finanzieren, werden Aufschläge in Höhe von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch, 15 Cent pro Kilogramm Butter, Käse und Milchpulverprodukte sowie 2 Cent pro Kilogramm Milch-, Frischmilchprodukte und Eier benötigt. Die Fragen, wie und wann eine derartige Tierwohlabgabe eingeführt und wo die Preisschraube innerhalb der Wertschöpfungskette konkret angesetzt werden soll, bleiben allerdings nach wie vor unbeantwortet. Zumal Lösungsansätze vor dem Hintergrund des internationalen Marktes noch zahlreiche weitere Fragen aufwerfen.
Denn nicht nur Aldi zeigt sich innerhalb des Fleischhandels als der „Erfinder von günstig“. Innerhalb der Fleischproduktion hat Deutschland laut dem Europaabgeordneten Martin Häusling (Die Grünen) das System „Billig, Billig, Billig“ nicht nur auf die Schlachthöfe übertragen, sondern dort auch noch perfektioniert. Tiefstpreise auf Kosten der Arbeitsbedingungen und Löhne der Arbeiter ermöglichen es den deutschen Schlachthöfen, so billig wie kaum anderswo in Europa zu schlachten. Die Folge: Umliegende Länder wie Frankreich, Belgien, Holland und Dänemark bringen ihr Vieh lieber nach Deutschland, als es im eigenen Land zu schlachten. Während im umliegenden Ausland Stellen abgebaut werden und Schlachthöfe Pleite gehen, konzentriert sich die Fleischwirtschaft in Deutschland auf eine Handvoll Großkonzerne mit Tönnies an der Spitze. Diese drücken ebenso wie die Lebensmittelhändler und Discounter gewaltig an der Preisschraube – mit der Folge, dass sich Deutschland innerhalb der Fleischindustrie längst in ein Billiglohnland verwandelt hat. Mittlerweile tötet die deutsche Schlachtindustrie über 750 Millionen Tiere pro Jahr. Weitreichender Nebeneffekt der Konzentration und Verlagerung der Tierschlachtungen in Europa sind mehr und längere Tiertransporte als noch vor 20 Jahren.
Meet and greet
Dass Fleischkonsum nicht zwangsläufig mit Tierquälerei und Massentierhaltung zu tun haben muss, zeigen Biohöfe, auf denen Schweine, Rinder und Geflügeltiere mit ausreichend Platz, Auslauf oder Freilandhaltung eine zufriedenstellende bis durchweg artgerechte Haltung und Fütterung genießen. Als durchweg positiv für die Entwicklung des Tierwohls in Deutschland ist die stetige Zunahme an Biohöfen in Deutschland zu bewerten: Seit 2006 hat sich die Anzahl der ökologisch wirtschaftenden Agrarbetriebe auf mehr als 33.500 Betriebe verdoppelt. Rund 5.500 davon haben sich der artgerechten Aufzucht von Mastvieh verschrieben. Das Problem: Je nach Tierart kostet Bio-Fleisch zwischen 1,5 bis 5,5 Mal so viel wie „konventionell“ produzierte Produkte aus der Massentierhaltung. Und genau hier liegt die Krux: Denn obwohl die breite Bevölkerung durchaus bereit wäre, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn es den Tieren während der Haltung besser geht, klettern die Preise für ein Kilogramm Hühnerbrust schnell ins Astronomische: 30 Euro pro Kilogramm können hier durchaus drin sein – das entspricht ungefähr den Kosten eines biologisch produzierten Schweinefilets.
Um die Waren auch an den Konsumenten zu bringen, bedarf es für die Bio-Höfe besonderes Engagement bei der Vermarktung. Zumal ihre Klientel nur selten durch die Supermarktläden schlendert, sondern Fleisch bewusster einkauft und ebenso bewusst nach einem Kaufanreiz sucht – das billigste Produkt hat für diese Klientel schließlich ausgedient. Einige Betriebe spezialisieren sich beispielsweise auf seltene Rassen oder selbstgesetzte Qualitätsstandards mit bäuerlich-handwerklichen Produktionsketten, die sie auf einem Erlebnisbauernhof auch für Interessenten erlebbar machen. Wieder andere gehen auf Tuchfühlung mit den Kunden und vermarkten ihre Produkte direkt auf Bauernmärkten sowie Hof- oder Bauernläden – rund acht Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe setzen bereits auf diese Form der Direktvermarkung. Doch auch das Angebot in der regionalen Metzgerei verspricht Erfolge, wenn die Kunden über die kurzen Wege oder die Herkunft der Produkte aufgeklärt werden können und eine ehrliche Beziehung aufgebaut werden kann. Denn gerade bei Bioprodukten heißt es für die Produzenten, Transparenz zu ermöglichen.
Welche Möglichkeit sich ergeben, wenn Risikobereitschaft und Kreativität auf das Internet treffen, zeigt das ungewöhnliche Konzept des Kuh- oder Schweine-Leasings. Hier zahlt der Kunde nicht für ein bestimmtes Stück Fleisch, sondern finanziert mit regelmäßigen Beiträgen die Aufzucht eines Kalbs oder Ferkels. Wann das Tier geschlachtet wird und zu welchen Produkten es verarbeitet wird, bestimmen dabei die Verbraucher. Ähnlich verhält es sich mit dem sogenannten Crowdbutchering. Hier bestellen die Interessenten ein bestimmtes Paket von einer Kuh oder einem Schwein von einem bestimmten Hof über eine Vermittlungsplattform. Ist die Kuh zur Gänze verkauft, wird sie geschlachtet, zerlegt und verschickt.
Eine weitere Möglichkeit, die Vermarktung von Bio-Fleisch zu unterstützen und an garantiert artgerechtes Fleisch zu kommen, ist der Einkauf beim Jäger. Hier ist das Angebot zwar auf Wildfleisch beschränkt, dennoch können die Konsumenten darauf vertrauen, dass das Tier so natürlich und ursprünglich aufgewachsen ist wie nur möglich.
Fleisch der Zukunft
Für viele ist der Fleischkonsum dennoch längst überkommen. Für sie steht fest: Egal wie artgerecht ein Tier aufgewachsen ist, der Mensch beendet das Leben dieses Tieres meist schon nach einem Bruchteil der maximalen Lebenszeit. Für ein zartrosafarbenes Wiener Schnitzel wird ein Kalb beispielsweise nach rund 22 Wochen geschlachtet – bei einer Lebenserwartung von 20 Jahren. Regelmäßige Skandale innerhalb der Fleischproduktion, die standardmäßige Haltung der Tiere in der Massentierhaltung der Haltungsform 1 und 2 sorgen für ein Übriges. Die Bewusstwerdung der Missstände und ein sich immer stärker manifestierender Pathozentrismus haben in den letzten 20 Jahren zu einer immer größer werdenden Anzahl von Vegetariern und Veganern geführt. Aktuell verzichten in Deutschland laut dem Vegetarierbund ProVeg Deutschland rund acht Millionen Menschen auf Fleisch und ernähren sich demnach entweder vegetarisch oder rein vegan. Dennoch scheint sich auch bei den meisten Personen, die bewusst auf Fleisch verzichten, ein Trend wenn nicht sogar Hype abzuzeichnen: Fleischersatz. Egal ob vegane Burger bei McDonald‘s, vegane Nuggets bei KFC oder vegane Wiener aus dem Kühlregal – Firmen wie Beyond-Meat, Redefine Meat oder Air Protein und andere Unternehmen arbeiten längst an der Revolution des Fleischmarktes. Während Beyond-Meat noch einen nachvollziehbaren Weg beschreitet und Fleischpatties mittels pflanzlichen Proteinen zu imitieren versucht, gehen Start-ups wie Redefine Meat aus Israel und Air Protein aus Kalifornien jeweils einen Sonderweg: Die einen wollen Fleisch drucken, die anderen Proteine aus der Raumluft herstellen.
Fleisch aus dem 3D-Drucker klingt zwar nach Science-Fiction, ist aber schon heute möglich. Seit rund zwei Jahren arbeitet ein 25-köpfiges Team, bestehend aus Ingenieuren und Technikern sowie einem Nahrungsmittelexperte und einem Spitzenkoch, an Fett-, Blut- und Protein-Imitaten auf pflanzlicher Basis. Mit einem speziellen 3D-Drucker bringen sie die Bestandteile schließlich in täuschend echte Form – und das nicht nur rein optisch. Auch die Textur von Muskeln und Fett soll dabei nachgeahmt werden. Insgesamt hat das Team 70 Parameter entwickelt, um Fleisch so gut es geht, zu imitieren. Selbst Kundenwünsche wie mehr oder weniger fettes Fleisch lassen sich mit dem 3D-Drucker in die Tat umsetzen. Das gedruckte Steak aus veganen Zutaten soll in etwa genauso viel kosten wie sein natürlich gewachsenes Vorbild. Nur dass ein Steak keine tausende Liter Wasser verbraucht und mehrere Monate zum Wachsen benötigt. Die schnellste Maschine schafft aktuell rund 50 Steaks pro Stunde.
Die Idee von Air Protein basiert auf Forschungsergebnissen der NASA, die in den 1960er Jahren eine besondere Bakterienart – sogenannte Hydrogenotrophen – entdeckt hatte. Die Eigenheit der Bakterien liegt darin, dass sie Kohlenstoffdioxid in Proteine umwandeln, die aus vergleichbaren Aminosäuren wie Fleisch bestehen sollen. Anders als Redifine Meat geht es Air Protein aber weniger um die nahezu perfekte Imitation von Fleisch als vielmehr um die Ersetzung der Soja-Bohne als Hauptprotein von Vegetariern. Die Bakterien seien dabei in der Lage, auf derselben Fläche 10.000 Mal mehr Protein herzustellen als Soja-Bohnen. Und das bei einem 2.000 Mal geringeren Wasserverbrauch und ganz ohne Einsatz von Pestiziden.
„Der Mensch ist, was er isst“
Eins steht jedoch fest: Vom moralischen Standpunkt aus würden sich nur die wenigsten Menschen für Fleisch aus der Massentierhaltung entscheiden – wenn überhaupt. Dennoch haben uns die Lebensmittelhändler mitsamt ihrem jahrzehntelang geführten Preiskampf an billige Fleischpreise und einen erhöhten Fleischkonsum gewöhnt. Werbeslogans wie „Fleisch ist ein Stück Lebenskraft“ aus dem Jahr 1967 bestimmen zudem unsere Wahrnehmung von Fleisch als notwendiges Konsumgut. Wenn der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger konstatiert, dass der reduzierte Fleischkonsum nur etwas „für einen Büromenschen auf dem Vegan-Trip“ sei, ein Bauarbeiter am dritten Tag aber vom Gerüst fallen würde, wenn er nur einmal pro Woche Fleisch isst, unterstreicht dabei nur die gefühlte Notwendigkeit von Fleisch. Aktuell verzehrt der Deutsche mit 1,1 Kilogramm Fleisch pro Woche allerdings rund das Doppelte bis Vierfache von der DGE empfohlenen maximalen Fleischmenge von 300 bis 600 Gramm. Würde man den Fleischkonsum reduzieren, würden sich auch finanzielle Spielräume für leidfreies Fleisch ergeben. Am Angebot – wie uns die Supermärkte mit ihrer eingeschränkten Auswahl suggerieren – liegt es aber schon mal nicht. Internetplattformen wie dein-bauernladen.de oder mein-bauernhof.de versuchen seit langem, Biohöfen bei der Direktvermarktung zu helfen, indem sie diese für die Verbraucher im Internet schneller auffindbarer machen und listen. Ähnlich verhält es sich mit der Vermarktung von Wildbret: Auch die bayerischen Staatsforsten listen auf ihrer Internetpräsenz baysf.de zahlreiche Wildverkaufsstellen übersichtlich auf und ermöglichen somit den direkten Kontakt zwischen Produzent und Abnehmer.
„Der Mensch ist, was er isst“ - Ludwig Andreas Feuerbachs Sinnspruch impliziert im Kern die kulinarische Selbstbestimmung des Menschen. Zum einen muss sich der Mensch weder an ein Nahrungsmittel gebunden fühlen, noch muss er etwas aus ethischen oder religiösen Gründen verwehren, was unter die Nahrung des Menschen fällt. Genauso wenig ist der Mensch von einem Lebensmittel derart abhängig, dass er unglücklich oder außer sich vor Ärger sein muss, wenn er es entbehren muss. Die Wahl liegt somit ganz in seinen Händen.
Meat and greed? – Iss gut jetz’
- Details
- Kategorie: Panorama
- | filterVERLAG