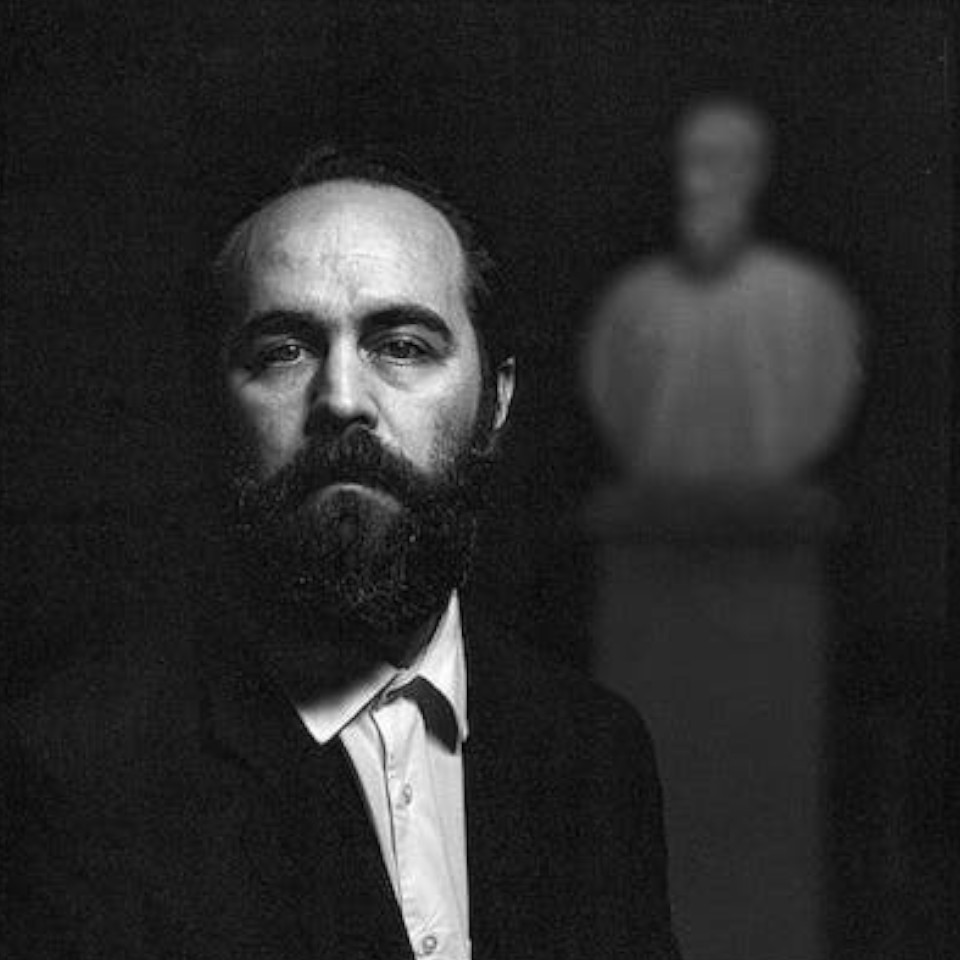Das „Pandemie-Versagen“ der Pflegeheime
- Details
- Kategorie: Panorama
- | filterVERLAG
Bereits mehr als 60.000 Todesopfer hat die Pandemie bis jetzt in Deutschland gefordert. Zwei Drittel davon sollen Schätzungen zufolge zuvor in Alten- und Pflegeheimen gelebt haben. Für Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, das Ergebnis eines angeblichen „Pandemie-Versagens“ der Pflegeheime. Wir haben die Verantwortlichen des Caritasverbands Regensburg mit dieser Aussage konfrontiert und klären auf, was die Pflegeheime unternehmen, um ihre Bewohner zu schützen und wie sich die Pandemie auf die Bewohner und Mitarbeiter auswirkt. Rede und Antwort standen uns Mechthild Hattemer, Geschäftsführerin der Caritas Wohnen und Pflege gGmbH, sowie Dr. Robert Seitz,
Abteilungsleiter Soziale Einrichtungen und Vorstandsmitglied des Verband der katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD).
Wie ist aktuell die Situation in Ihren Pflegeeinrichtungen?
Hattemer: Aktuell ist die Infektionslage in den Häusern etwas abgeflacht. Ein Infektionsgeschehen haben wir derzeit in drei Einrichtungen zu verzeichnen. Die Situation ist aber sehr dynamisch, sodass es immer wieder mal zu einem Aufflammen von Corona-Infektionen kommt. Insgesamt ist die Situation tagesfüllend und mit Blick auf die Anforderungen sehr aufwendig. Teilweise kommt es an einem Tag zu mehreren Neuerungen von Seiten des RKI, des bayerischen Gesundheitsministeriums, der Heimaufsichten oder der Gesundheitsämter. Momentan sind wir auch mit den Vorbereitungen der Covid-19-Schutzimpfungen beschäftigt. Die einzuholenden Einverständniserklärungen und damit verbundenen Informationen für Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter und Bewohner fordern zusätzliche Zeit und Aufmerksamkeit. Wir gehen aber auch davon aus, dass der Aufwand in absehbarer Zeit nicht weniger werden wird.
Wie gehen die Bewohner mit dieser Dauerbelastung um?
Hattemer: Der Umgang mit der Situation gestaltet sich für die Bewohner als allgemein schwierig. Zumal die Verweildauer in den Einrichtungen je nach Grunderkrankung unterschiedlich lange ist. Viele der Bewohner sind schwer krank, was die Situation zusätzlich erschwert. Zum Teil erleben wir ganze Heimaufenthalte unter dem Thema Corona. Aber auch für Bewohner, die seit Längerem in den Heimen leben, ist die Situation belastend. Viele haben Angst, da das Thema Corona tagesfüllend ist. Schon beim Blick in die Zeitungen sehen die Bewohner die Todeszahlen, werden mit Sterberaten und Bildern von Intensivstationen konfrontiert. Die Bewohner schildern auch, dass man im Fernsehen nur noch Intensivstationen, vermummte Leute, Testungen, Spritzen oder Todeszahlen sieht. Die Bewohner können dem Thema also nicht ausweichen.
Existiert Ihrer Meinung nach eine negative Überbetonung innerhalb der Berichterstattung?
Hattemer: Es ist natürlich einfach, Zahlen zu kommunizieren. Wenn ich schreibe, in der Einrichtung Y wurden 30 von 60 Bewohnern positiv getestet, dann ist das erst mal eine Zahl, die nicht viel aussagt. Dass von diesen 30 aber viele wieder gesund werden, wird meist nicht mehr kommuniziert. Was hängenbleibt, ist die Dramatisierung der Berichterstattung. Aus Sicht der Betroffenen sind diese Schlagzeilen aber immer sehr belastend. Die Bewohner schlagen die Zeitung auf und sehen erst einmal Senioren sterben. Was sie dabei nicht sehen, ist die Tatsache, dass es sich bei den Erkrankten nur um einen Teil der Bewohner handelt und dass viele davon auch wieder genesen und oft wenig Symptome haben. Es gibt viele ältere Menschen, die kaum bemerken, dass sie Corona, sondern nur ein bisschen Schnupfen oder was auch immer haben. Ohne dass man an dieser Stelle Corona klein reden will, schafft das Auslassen dieser positiven Meldungen aber Angst, sodass Corona bei den Bewohnern klar angstbesetzt ist.
Hoffnung versprechen die in Deutschland neuzugelassenen Impfstoffe. Gerade Heimbewohner und Pflegepersonal zählen hier zu den erstpriorisierten Personen. Wie viele davon konnten bislang in Ihren Einrichtungen geimpft werden? Und wie groß ist die Impfbereitschaft in den Heimen?
Hattemer: Von den insgesamt 25 stationären Einrichtungen hatten bis zum jetzigen Stand (18. Januar 2021, Anm.d.Red.) bereits 23 Häuser einen Impftermin. Ein Haus in Waldsassen hatte sogar bereits den zweiten, da die Erstimpfung bereits am 27. Dezember erfolgt war. Von den Bewohnern ist die Bereitschaft verhältnismäßig groß. Wir liegen bei etwa 60 bis 70 Prozent, die impfwillig sind. Vonseiten der Mitarbeiter sind wir aktuell bei ungefähr 40 Prozent.
Wie bewerten Sie die Möglichkeit einer Impfpflicht für das Pflegepersonal, wie sie jüngst vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ins Spiel gebracht wurde?
Seitz: Eine Impfung ist immer mit Fragen verbunden. Und wenn man im eigenen Umfeld und den sozialen Medien beunruhigende Antworten wie eine mögliche Unfruchtbarkeit findet, sind Unruhen die natürliche Folge. Somit ist es wichtig, mit Vorurteilen aufzuräumen – in erster Linie mit dem Thema Unfruchtbarkeit, das viele Pflegekräfte in den Heimen umtreibt. Eine besondere Rolle kommt hier den Medien zu, die mit entsprechenden Rubriken aufklären und beruhigen wollen. Aber auch Führungskräfte nehmen eine Schlüsselrolle ein. Diese müssen mit gutem Beispiel vorangehen und sich impfen lassen, sodass sich im Verbund mit der Aufklärung auch möglichst viele Personen sowie Angestellte impfen lassen wollen. Eine Impfpflicht ist nicht nur aus rechtlicher Sicht als kritisch zu bewerten. Ein Impfzwang für das Pflegepersonal führt weder dazu, dass sich Pflegekräfte wertgeschätzt fühlen, noch dass sich junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern lassen.
Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz wirft der Altenpflege ein „Pandemie-Versagen“ vor. Laut Vorstand Eugen Brysch sei für die hohen Infektionszahlen auch eine mangelnde Hygiene in den Heimen verantwortlich. Was stehen Sie zu dieser Aussage?
Hattemer: Die Aussage hat mich, ehrlich gesagt, in meiner Berufsehre sehr getroffen. Im Grunde genommen wird hier die Schuld pauschal den Mitarbeitern in den Pflegeheimen zugeschoben. Die Aussage war schließlich, dass es Hygienemängel gegeben habe, die letztendlich zu den hohen Todeszahlen geführt hätten. Und wenn die Mitarbeiter hygienischer arbeiten würden und mehr Kontrollen vorhanden wären, wären die Sterbefälle niedriger. Diese Aussage zeugt für mich von einer gewissen Ahnungslosigkeit. Die Pandemie war zu Beginn für alle eine Situation, an die wir uns herangetastet haben – auch die Wissenschaftler. Es wurde untersucht, welche Übertragungswege es gibt, welche Hygienemaßnahmen es dagegen gibt und was konkret unternommen werden kann. Und das waren ja alles Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die es schon immer gab. Es gab schon immer ein Rahmenhygieneplan, nach dem gearbeitet wird. Es gab schon immer Ausbrüche von Viren wie dem Norovirus, womit seit jeher adäquat umgegangen wird – und das alles immer in engster Abstimmung mit den Behörden und Gesundheitsämtern. Den Altenheimen vorzuwerfen, sie wären schuld am Tod der verstorbenen Bewohner, finde ich relativ schamlos.
Was wird konkret getan, um die Gesundheit der Pflegenden und der Bewohner zu schützen?
Hattemer: Das beginnt damit, dass die Mitarbeiter angehalten sind, sich selbst zu beobachten und bei Symptomen sofort zum Arzt zu gehen und das den Vorgesetzen zu melden. Wir haben regelmäßige Antigen-Schnelltests, die sowohl für die Mitarbeiter als auch die Bewohner zur Verfügung stehen und durchgeführt werden. Ebenso stehen den Pflegeheimen OP-Masken wie auch FFP2-Masken bei Verdachtsfällen und Ausbrüchen zur Verfügung. Die Einrichtungen verfügen zudem über Schutzkittel mit Visieren und Schutzbrillen, über Desinfektionsmittel sowie Handschuhe in verschiedenster Art wie auch hochwertige Nitril-Handschuhe. Ebenso haben wir Desinfektionsmittelspender für Besucher und Besucherfenster für jene, die ihre Angehörigen besuchen, aber nicht ins Haus kommen wollen. Mit den externen Therapeuten haben wir vereinbart, dass sie Tests machen können, falls sie dies nicht schon von sich aus tun. Zusätzlich haben wir telefonische Arztgespräche und abgeänderte Übergabegespräche, die entweder telefonisch oder auch schriftlich stattfinden. Wir betreiben also einen sehr großen Aufwand, damit der Kontakt so gering wie möglich, der Schutz der Mitarbeiter und Bewohner aber zugleich so hoch wie möglich ist.
Seitz: Zum Schutz der Bewohner gehört natürlich auch der Schutz vor Vereinsamung. Hierzu zählt auch das Herstellen eines telefonischen Kontakts mit den Angehörigen. Soweit es möglich ist, wird dabei auch auf die modernen Medien wie Videotelefonie zurückgegriffen, um mit den Angehörigen, die nicht mehr ins Heim kommen können, in Kontakt zu treten.
Seit wann gibt es FFP2-Masken in den Heimen und bei welchen Gelegenheit ist das Tragen eine Pflicht?
Hattemer: FFP2-Masken sind schon immer vorhanden und im Gebrauch. Bisher war das Tragen bei Corona-Verdachtsfällen, Ausbruchssituationen, Quarantänesituationen der Bewohner und natürlich bei positiven Bewohnern Pflicht. Dies ändert sich aber je nach Vorgaben der Behörden. Aktuell werden laut Vorgaben immer bei Kontakt mit Bewohnern in den Heimen FFP2-Masken getragen.
Wie kommen diese hohen Todeszahlen Ihrer Meinung nach zustande?
Hattemer: Bei den Bewohnern eines Pflegeheimes handelt es sich sehr selten um kerngesunde Personen, die ihren Lebensmittelpunkt verlagern wollten. Man muss sich vor Augen halten, dass die meisten Bewohner sehr kranke, zum Teil mehrfach erkrankte, ältere Damen und Herren sind, die sich oftmals am Lebensende befinden. Nicht selten kommen die Menschen zur Sterbezeit ins Altenheim und sind multimorbid krank. Zusätzliche Erkrankungen wie ein Corona-, Noro- oder Grippe-Virus oder aber auch nur ein Sturz stellen für diese Menschen eine massive zusätzliche Belastung dar, die unter Umständen zum Tod führen kann. Ich sehe hier also weniger ein Versäumnis vonseiten der Einrichtungen, Mitarbeiter oder Behörden als eine erhebliche Zusatzbelastung für einen geschwächten Menschen, der damit womöglich nicht mehr umgehen kann.
Seitz: Diese Einschätzung wird auch von der Wissenschaft geteilt. Das Durchschnittsalter der Corona-Verstorbenen beträgt 82 Jahre, laut einer Untersuchung des Direktors der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf Benjamin Ondruschka. Die allermeisten Verstorbenen hatten dabei Vorerkrankungen. Unabhängig von Corona beläuft sich die Verweildauer der Pflegeheimbewohner im Schnitt auf etwa anderthalb Jahre. Die Gefahr des Versterbens ist hier also ungemein höher. Nüchtern betrachtet ist es also nicht überraschend, dass an dem Ort, an dem viele Menschen leben, die dem Tod ohnehin näher stehen als dem Leben, Corona-Tote statistisch signifikant häufiger aufzufinden sind. Deshalb ist es auch wichtig, in den Heimen besonders vorsichtig zu sein und die ausgeführten Schutzvorkehrungen einzuhalten.
Zu den Schutzbemühungen zählten auch strikte Besuchsverbote. Gerade für ältere Menschen ist der Kontakt mit Familie aber immens wichtig. Wie schwer wiegt hier die Einsamkeit?
Seitz: Die Bewohner leiden massiv unter Vereinsamung. Gerade im ersten Lockdown konnten wir beobachten, dass sich die Heimbewohner verändern, sobald die Kontakte zu ihren Angehörigen wegbrechen. Der Nebeneffekt der Vereinsamung ist bei dieser Schutzmaßnahme so groß, dass kaum noch Einrichtungen darauf zurückgreifen.
Hattemer: Hier möchte ich sogar unterstellen, dass die Folgen eines Besuchsverbots nicht wirklich durchdacht waren. Besonders kritisch am Besuchsverbot habe ich die Ungleichbehandlung der Bewohner empfunden. Nur weil sie in einer Einrichtung ein Zimmer gemietet haben anstatt in einer eigenen Wohnung zu leben, wurde ihnen die freie Entscheidung über ihren Besuch genommen. Selbst wenn diese Vorgabe von der Politik gut gemeint war, tue ich mich in Hinblick auf die Freiheit des Einzelnen immer noch schwer damit. Insofern bin ich froh, dass die Besuchsfreiheit wieder hergestellt wurde. Wenn auch mit berechtigten Vorgaben wie einer FFP2-Maske.
Wie stark wurden die Einrichtungen der Caritas Regensburg von der Corona-Pandemie betroffen? Und wie viele Ihrer Bewohner sind an Corona verstorben?
Hattemer: Die meisten Einrichtungen unseres Caritasverbandes blieben von massiven Ausbrüchen des Coronavirus verschont oder sogar ganz coronafrei. Es gibt zwar immer wieder Ausbrüche mit Infizierten, von denen die allermeisten die Krankheit aber nach zwei Wochen überstanden haben. Um die Dimension genauer abzuschätzen: In den 21 Einrichtungen der Caritas Wohnen und Pflege gGmbH stationären Einrichtungen mit 1.600 Plätzen sind aktuell 52 Personen an oder mit Corona verstorben.
Wenn Sie die Pandemie bislang Revue passieren lassen, was waren und sind die gravierendsten Folgen und Auswirkungen für die Heime?
Hattemer: In den letzten Monaten war sehr viel Negatives über Alten- und Pflegeheime in den Medien, was diese Einrichtungen zum einen nicht sonderlich attraktiv gemacht und zum anderen deren Bewohner sehr verunsichert hat. Ebenso wirft sie Fragen nach der Sicherheit und Attraktivität des Pflegeberufs auf, wenn er immer in den Zusammenhang mit der Pandemie und negativen Schlagzeilen gebracht wird.
Seitz: Vielleicht ergibt sich durch die Pandemie aber auch die Chance, dass die Pflege endlich gehört wird. Es gab viel Applaus für die Pflege von den Balkonen, Schokolade oder Bonuszahlungen für Pflegekräfte. Das Thema Pflege ist nun zumindest in den Köpfen. Wenn es uns gelingt, diesen kurzfristigen Applaus zu verstetigen und eine nachhaltige Wertschätzung für die Pflege zu erreichen, dann hätte Corona wenigstens in Grenzen etwas Positives gehabt.