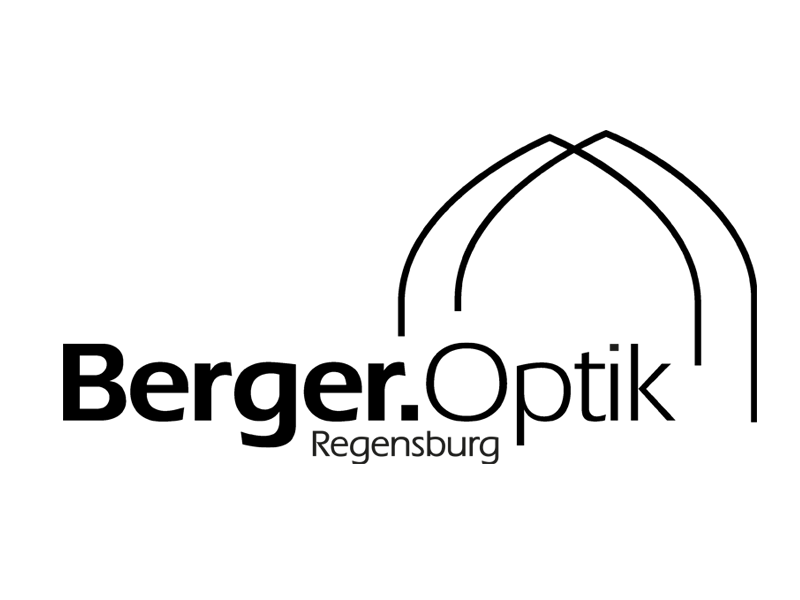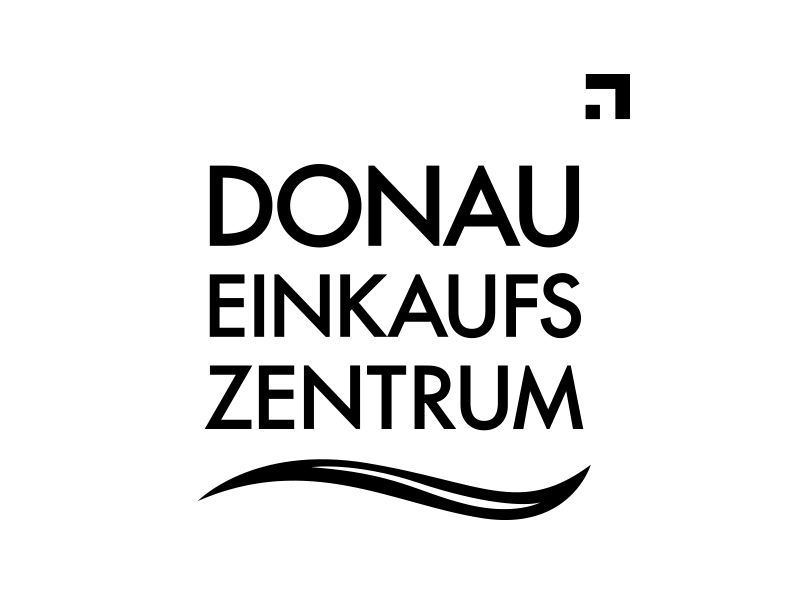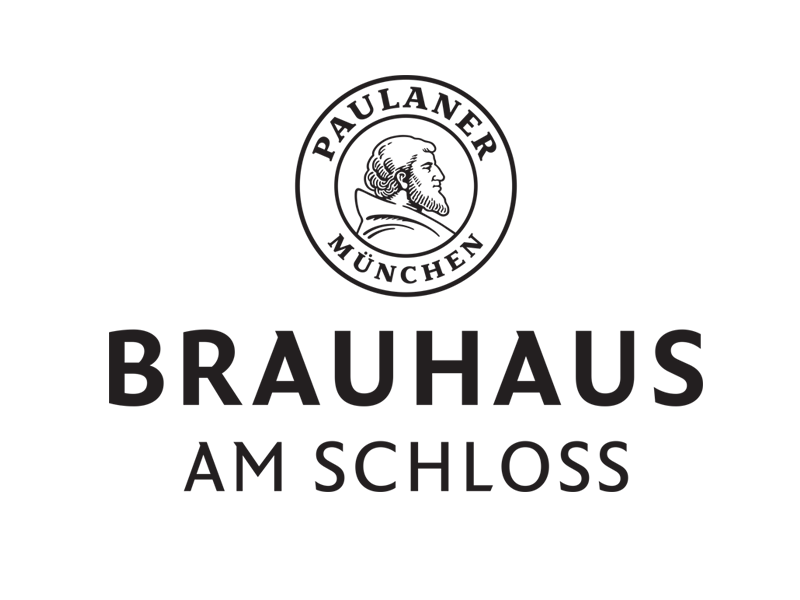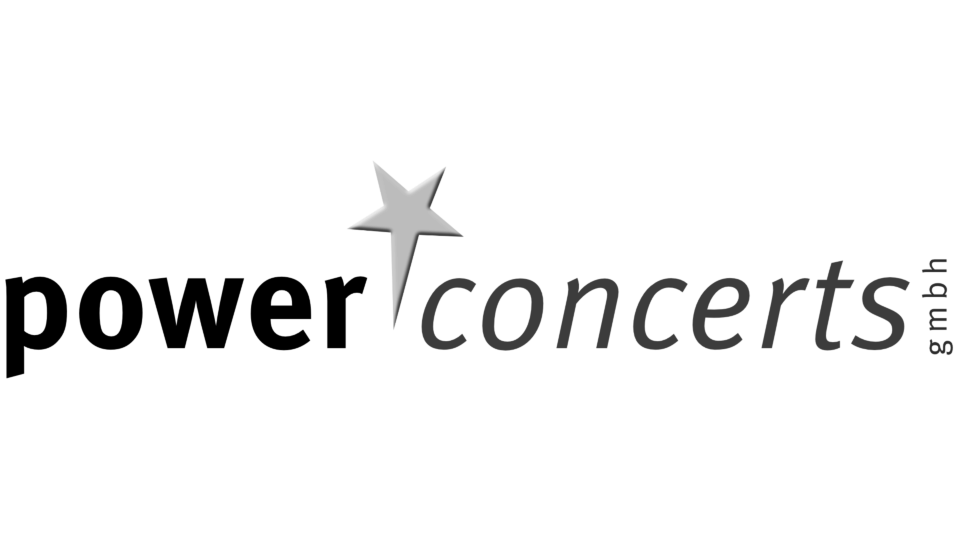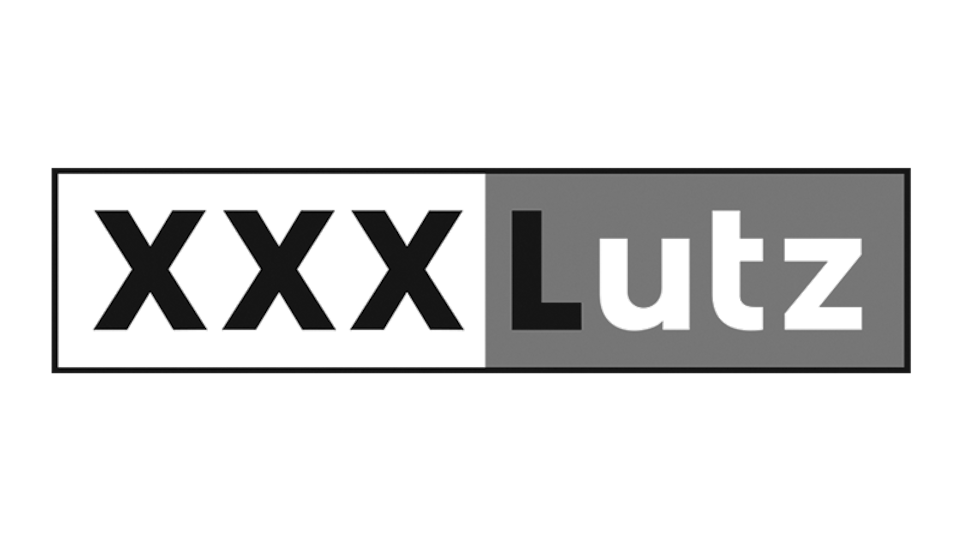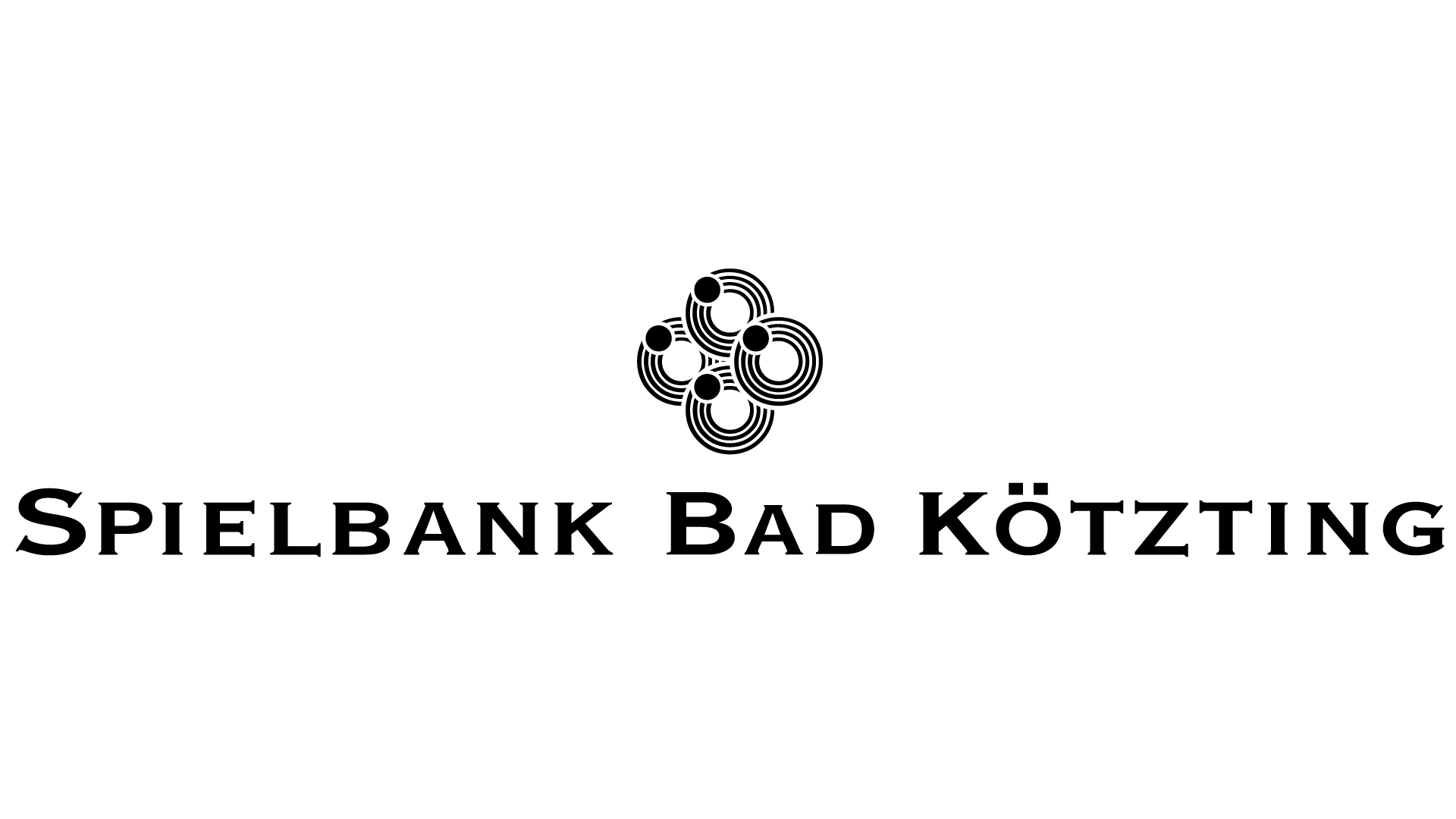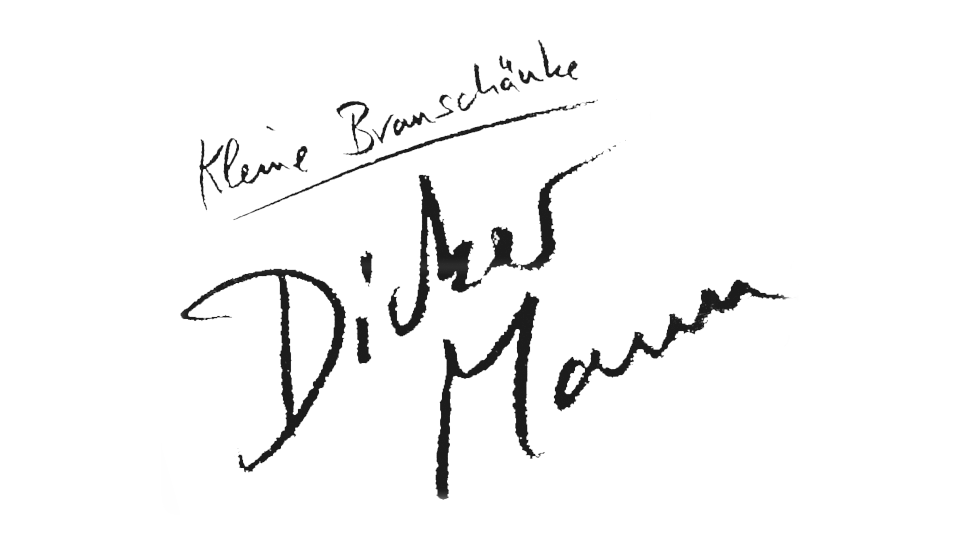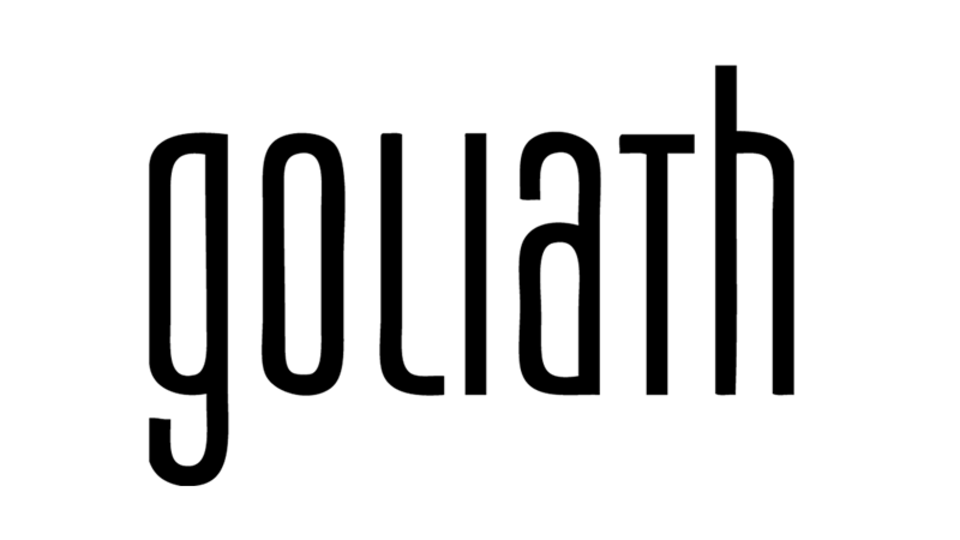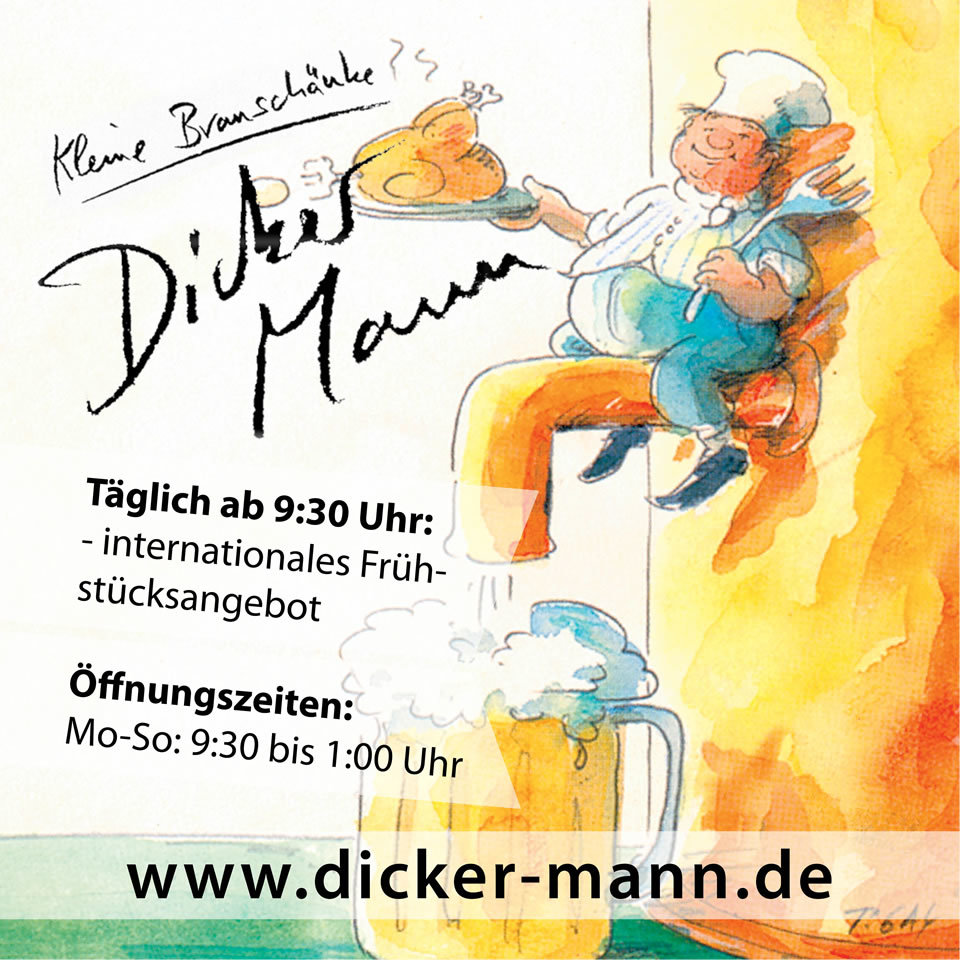Zusatzstoffe begegnen uns tagtäglich in den Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen. Doch tatsächlich sind viele dieser Stoffe nicht so unbedenklich, wie uns oft glaubhaft gemacht wird.
Sie machen unsere Lebensmittel schöner, schmackhafter und länger genießbar – Zusatzstoffe. Vor allem bei stark verarbeiteten Lebensmitteln greift die Industrie tief in die chemische Trickkiste, um neben Konsistenz und Geschmack auch technische Produktionsabläufe sicherzustellen. Auf ihre Sicherheit geprüft sind davon zwar alle, dennoch sind viele der Stoffe längst nicht so unbedenklich, wie ihre Zulassung uns glaubhaft machen möchte. Zumal in der EU Zusatzstoffe zugelassen sind, die in Ländern wie den USA verboten sind.
Win-Win-Win Situation für die Lebensmittelindustrie
Was wäre die Welt ohne Lebensmittelzusatzstoffe wie Stabilisatoren, Emulgatoren oder Konservierungsstoffe? Zwar keine schlechtere, aber zumindest eine, in der Fertigsalate bereits nach wenigen Stunden unappetitlich aussehen, in der sich alle Fruchtstückchen eines Joghurts am Becherboden befinden und in der Tiefkühltorten sich beim Auftauen langsam, aber sicher in eine matschige Pampe verwandeln. Was in erster Linie nach einem Benefit für die Verbraucher klingt, ist im eigentlichen Sinne eine Win-Win-Win-Situation für die Lebensmittelindustrie. Denn Zusatzstoffe ermöglichen es der Industrie nicht nur, stetig neue Produkte zu erfinden, sondern diese zugleich schneller und billiger zu produzieren und gleichzeitig länger haltbar zu machen. Überdies können Lebensmittel sogar standardisiert werden, sodass sich die Produkte beim Verlassen der Produktionsstätte wie ein Ei dem anderen gleichen. Lebensmittelzusätze sorgen meistens nicht nur dafür, dass die Lebensmittel so aussehen, riechen und schmecken, wie wir sie kennen, sondern auch dafür, dass Geschmack, Farbe, Form und Geruch so ausfallen, wie es die Lebensmittelindustrie für attraktiv und werbewirksam hält.
Aktuell sind etwa 316 Zusatzstoffe mit unterschiedlichen Funktionen in der EU zugelassen, darunter:
- Farbstoffe, die Lebensmitteln eine appetitliche Farbe verleihen
- Konservierungsstoffe, die Mikroorganismen hemmen
- Antioxidationsmittel, die eine Reaktion mit Luftsauerstoff verhindern
- Emulgatoren, die eine Bindung von nicht mischbaren Stoffen ermöglichen
- Verdickungsmittel, die die Konsistenz von Puddings verbessern
- Geschmacksverstärker, die für Geschmack sorgen, wo eigentlich keiner ist
- Süßstoffe, die eine kalorienarme Süße verleihen
- und Stabilisatoren, die Farbe, Konsistenz und Geschmack erhalten
Trotz ihres Nutzens ist der Konsum zahlreicher Zusatzstoffe nicht unbedenklich: Nicht wenige stehen sogar im Verdacht, Allergien auszulösen und Krankheiten zu begünstigen – darunter Neurodermitis, Asthma, Alzheimer oder sogar Krebs.
Garantiert sicher?
Während in Deutschland bis 1993 nur 265 Zusatzstoffe erlaubt waren, hat die Angleichung mit den EU-Gesetzen zu einer Erweiterung der Zusatzstoffpalette geführt. Alle der heute in der EU erlaubten 316 Lebensmittelzusatzstoffe wurden dabei durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) überprüft und zugelassen und gelten somit zumindest in der vorgesehenen Konzentration und Anwendung als gesundheitlich unbedenklich. Bei der Bewertung der Zusatzstoffe werden von der zuständigen Behörde alle verfügbaren und einschlägigen wissenschaftlichen Daten über die Toxizität der Stoffe ausgewertet und mit der geschätzten Aufnahme des Stoffes durch den Menschen abgeglichen. Ausgehend von diesen Daten wird anschließend die Sicherheit des Zusatzstoffes für den Menschen bewertet. Je nachdem, wie sicher ein Lebensmittelzusatzstoff eingestuft wird, definiert die EFSA entweder Höchstwerte oder stuft den Stoff als vollkommen unbedenklich ein. Als völlig unbedenklich gilt beispielsweise Calciumcarbonat (E 170), das vornehmlich Milchprodukte weiß färbt. Ebenso existieren keine Höchstmengen für Milchsäure (E 270), Speisefettsäuren (E 570) oder Stickstoff (E 941), der meist Teil der Schutzgasatmosphäre von verpackten Lebensmitteln ist.

Basis für die Festlegung einer Höchstmenge, die einem Lebensmittel zugesetzt werden darf, ist in der Regel der ADI-Wert. Dieser beschreibt die Acceptable Daily Intake, also die akzeptable tägliche Aufnahmemenge. Er bezieht sich dabei auf ein Kilogramm Körpergewicht und gibt die Menge eines Lebensmittelzusatzstoffes an, die ein Mensch ohne Bedenken ein Leben lang täglich zu sich nehmen kann. Der ADI-Wert basiert in der Regel auf Tierstudien, bei denen Tiere über einen längeren Zeitraum mit unterschiedlichen Dosen eines Zusatzstoffes gefüttert wurden. Abgeleitet wird die akzeptable tägliche Höchstmenge von der Höchstdosis, bei der keine schädlichen Wirkungen beobachtet werden konnten. Um negative Auswirkungen auf den Menschen auszuschließen, beträgt der ADI-Wert meist nur ein Hundertstel der im Tierversuch beobachteten Höchstmenge.
Da die meisten Daten und Bewertungen aus den Achtzigern und Neunzigern des vorangegangenen Jahrhunderts stammten, sollten zwischen 2009 und 2019 alle Zusatzstoffe einer Neubewertung unterzogen werden. Hierbei hat sich bei bestimmten Zusatzstoffen nicht nur der ADI-Wert, sondern auch die Sicherheitsbewertung verändert. So wurde 2012 aufgrund der erwarteten Belastung für die Gesundheit beispielsweise der ADI-Wert von den Farbstoffen Chinolingelb (E 104), Gelborange S (E 110) und Cochenillerot A (E 124) gesenkt. Ebenso gilt Titanoxid (E 171) seit Mai 2021 als potenziell unsicher – aufgrund fehlender Humanstudien ist der Farbstoff in Deutschland aber immer noch zugelassen.
Neben den gesundheitlichen Aspekten müssen die zugelassenen Zusatzstoffe aber noch weitere Kriterien erfüllen: So dürfen sie beispielsweise weder dazu verwendet werden, (um) den Verbraucher in die Irre zu führen, noch dürfen sie eine mangelhafte Qualität oder mangelnde Hygiene im Herstellungsprozess verschleiern. Insgesamt muss ihr Einsatz laut EU-Zusatzstoff-Verordnung eine hinreichende technische Notwendigkeit darstellen oder für den Verbraucher Vorteile wie ein verbesserter Geschmack oder längere Haltbarkeit bringen. Für manche gilt sogar eine spezifische Nutzung. Beispielsweise darf Natriumferrocyanid (E 535) nur in Salz als Rieselhilfe verwendet werden.
Kennzeichnungspflicht
Für Lebensmittelzusatzstoffe herrscht in der EU eine Kennzeichnungspflicht auf der Verpackung. Zudem sind alle Zusatzstoffe europaweit mit ein und derselben E-Nummer gekennzeichnet, worauf auch das „E“ (auch) verweist – dieses steht nämlich für Europa. Da die Zusätze als Zutaten gelten, müssen sie auch in der Zutatenliste der Produkte aufgeführt werden. Während es früher die Regel war, dass die Angabe der Zusatzstoffe über die entsprechenden E-Nummern erfolgte, haben mittlerweile viele Hersteller umgeschwenkt. Grund hierfür ist das immer schlechter werdende Image von E-Nummern, zumal sich Zitronensäure auch besser liest als E 330. Dennoch können Verbraucher Zusatzstoffe erkennen, da die Hersteller dazu verpflichtet sind, sowohl die Funktion (bspw. Antioxidationsmittel oder Farbstoff) als auch den verwendeten Zusatzstoff anzugeben. Hierbei muss die Funktion vor dem Namen des Zusatzstoffes stehen, beispielsweise „Farbstoff Amaranth“ oder „Farbstoff E 123“. Zusätzlich gilt, dass die Hersteller dazu verpflichtet sind, Allergene, also allergieauslösende Stoffe, gesondert zu kennzeichnen.
Dasselbe gilt auch für bestimmte Zusatzstoffe in unverpackter Ware – beispielsweise wenn sie Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder Konservierungsmittel enthalten. Die Kennzeichnung muss entweder in Kurzform auf einem unmittelbar neben der Ware postierten Schild geschehen oder in ausführlicher Weise mit einer allgemein zugänglichen Kladde. Ersteres bietet den Vorteil, dass der Verkäufer die Zusatzstoffe nicht nennen muss. Hier reicht ein Schild mit Hinweisen wie beispielsweise „gewachst“, „geschwärzt“, „geschwefelt“ oder „mit Geschmacksverstärker“ aus.

So vermeiden Sie E-Nummern:
Wer potenziell schädliche Zusatzstoffe in Lebensmitteln vermeiden möchte, dem bleibt beim Einkauf nur der genaue Blick auf die Zutatenliste. Um bedenkliche Inhaltsstoffe schnell zu identifizieren, eigenen sich auch E-Nummern-Apps, die beim Scannen des Barcodes potenziell gefährliche Inhaltsstoffe auflisten. Zusätzlich gilt: Je stärker ein Lebensmittel oder die Ausgangsstoffe verarbeitet sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Hersteller bei der Produktion auf relativ viele Zusatzstoffe zurückgegriffen hat.
Wer generell auf Nummer sicher gehen und den Konsum von Zusatzstoffen weitestgehend reduzieren möchte, sollte sich so viele Mahlzeiten wie möglich selbst zubereiten. Hierbei sollte beim Kauf nicht nur auf frische und weniger verarbeitete Lebensmittel wie Naturjoghurt oder Direktsäfte zurückgegriffen werden, ebenso kann es sich hier lohnen, Produkte mit dem EU-Bio-Siegel zu erwerben. Manche Bio-Verbände sind sogar noch strenger als die EU-Ökoverordnung. Bioland erlaubt beispielsweise nur etwa 25 Zusatzstoffe, Demeter sogar nur rund 20.
Zusätzlich kann es sicher nicht schaden, sich mittels Broschüren zu informieren. Das Buch „Was bedeuten die E-Nummern?“ der Verbraucherzentrale führt beispielsweise auf 88 Seiten alle bekannten Lebensmittelzusätze mitsamt den wichtigsten Fakten auf. Auch die E-Nummern-Abfrage des Bundeszentrums für Ernährung zeigt, ob eine E-Nummer potenziell bedenklich ist oder nicht.
RNRed