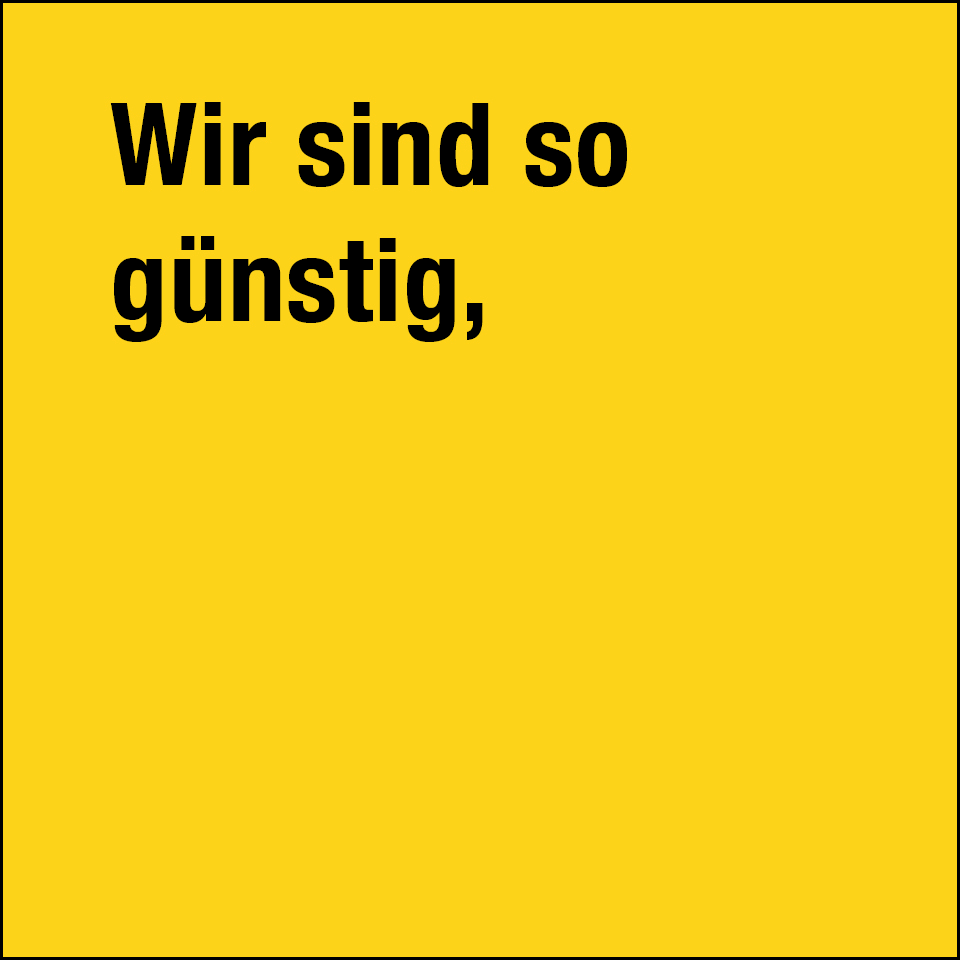Ärzte, Sanitäter und Pfleger sind im wahrsten Sinne des Wortes Retter in der Not. Sie stehen bereit, um Menschen zu helfen, egal zu welcher Uhrzeit, ob an Wochenenden oder Feiertagen. Grundsätzlich herrscht ein breiter Konsens darüber, dass diese Berufsgruppe einen ganz entscheidenden Beitrag in unserer Gesellschaft leistet und größte Wertschätzung verdient. Gleichzeitig wird medizinisches Personal immer wieder zur Zielscheibe aggressiven und gewalttätigen Verhaltens.
Rettungs- und Notfallkräfte sind sich sehr wohl bewusst, dass Patienten und Angehörige in Extremsituationen wie ärztlichen Notfällen unter großem Stress stehen. Angst kann schnell in Panik umschlagen und Kurzschlussreaktionen auslösen. So kann das Legen eines venösen Zugangs oder das Sichern eines Patienten mit Hilfe von Gurten und der damit empfundenen Hilflosigkeit Affekthandlungen auslösen. Stehen Patienten zudem unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, sind Handgreiflichkeiten oft vorprogrammiert.
Retter wissen, dass sie bei jedem Einsatz mit Auseinandersetzungen oder körperlichen Übergriffen rechnen müssen und sind darin geschult, Konflikte zu deeskalieren oder sich rechtzeitig zurückzuziehen, wenn Gefahr besteht – selbst verletzt zu werden. Abgesehen von diesen Situationen häufen sich aus Sicht der Betroffenen jedoch Fälle aggressiven Verhaltens wie Beleidigungen, Anzüglichkeiten oder Nötigung im Straßenverkehr bis hin zu Bedrohungen von Leib und Leben. Bilder, wie die gezielten Angriffe mit Steinen oder Feuerwerkskörpern zu Silvester, zeigen eine neue Dimension an Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft, die es bis dato nicht gab. Dabei sind Rettungskräfte bei weitem nicht die Einzigen, die davon betroffen sind. Auch Polizisten, Feuerwehrleute, medizinisches Personal, Lehrer, Politiker, Schiedsrichter und viele andere Berufsgruppen, die in direktem Kontakt zu Menschen stehen, sehen sich mit einer „generellen Verrohung“ der Gesellschaft konfrontiert.
Doch ist das wirklich so oder wird diese Sichtweise durch die Flut an negativen Schlagzeilen beeinflusst?
Gewalttaten auf Rekordniveau
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Bundesland Bayern erfasst unter der Rubrik Gewaltkriminalität unter anderem alle Fälle von Tötungs- und Körperverletzungsdelikten, Vergewaltigung, Raub und Erpressung. Im Jahr 2023 wurden 21.579 Taten erfasst. Das entspricht einer Steigerung von 4,7 Prozent, beziehungsweise 971 Fällen im Vergleich zum Vorjahr und einem Höchststand innerhalb der letzten zehn Jahre. Diese Tendenz setzt sich auch auf Bundesebene fort. Mit 214.099 Fällen verzeichnet die PKS eine Steigerung von 8,6 Prozent und auch hier einen traurigen Höchststand innerhalb der letzten zehn Jahre. Die zunehmende Aggression, über die vor allem Rettungssanitäter klagen, ist also keineswegs nur eine gefühlte Bedrohung, denn in einem vom Bundeskriminalamt (BKA) herausgegebenen Bundeslagebild „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte“ wurden auch Gewaltdelikte gegen Rettungskräfte erfasst. Das Ergebnis verzeichnet eine Zunahme von 6,8 Prozent zum Vorjahr und auch hier liegt die Zahl der Straftaten auf Rekordniveau. Täter waren vorwiegend Männer im Alter von 20-29 Jahren, die nicht selten unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss standen.

© Matthias Walk
Warum sich Aggression gegenüber denjenigen entlädt, die eigentlich nur helfen wollen, ist nicht so leicht zu erklären. Bei vorsätzlichen Taten wie gezielten Angriffen sind Motive wie Hasskriminalität, vor allem von rechts- und linksmotivierten Gruppen zu vermuten. Befragungen von Rettungskräften haben zudem ergeben, dass oft nicht zwischen Polizisten und Rettungskräften unterschieden wird. Vielmehr ist das Tragen einer Uniform Auslöser von Aggression und Gewalt. Dabei richtet sich die Frustration der Täter nicht unbedingt gegen einzelne Personen, sondern vielmehr gegen den Staat im Allgemeinen. Diese gefühlte Ablehnung „staatlicher Kontrolle“ wurde durch die weitreichenden Einschränkungen in der persönlichen Entscheidungsfreiheit während der Corona Pandemie zusätzlich befeuert. Doch auch finanzielle Stressfaktoren sowie die wachsende Zahl an Zuwanderern und deren eigene Gewalterfahrung bergen Potenzial für Konflikte.
Die in der PKS erfassten Zahlen sind alarmierend. Dabei handelt es sich jedoch nur um das sogenannte „Hellfeld“, also die gemeldeten und registrierten Straf¬taten. Um ein ganzheitliches Bild der Kriminalitätsentwicklung zu erhalten, muss man auch das sogenannte „Dunkelfeld“, also Straftaten, die aus verschiedenen Gründen nicht polizeilich erfasst wurden, miteinbeziehen. Diese werden derzeit in einer separaten Studie ermittelt. Dazu gehören vor allem Beschimpfungen, Be-drohungen oder Nötigung und diese stehen bei Rettungs- und Notfallkräften zwischenzeitlich an der Tagesordnung.
Kampagne #Gewaltangehen soll auf Problem aufmerksam machen
Sara Schätz, Rettungssanitäterin bei den Johannitern in Regensburg, hat selbst bereits zahlreiche Erfahrungen sowohl mit physischer als auch psychischer Gewalt in ihrem Arbeitsleben gemacht und muss jeden Tag aufs Neue verbale Entgleisungen über sich ergehen lassen. Besonders junge Frauen sehen sich unangemessenen Anzüglichkeiten und genereller Respektlosigkeit ausgesetzt. „Gefühlt werde ich bei jedem zweiten Einsatz blöd angequatscht, beleidigt oder angepöbelt“, so die Sanitäterin. Aus diesem Grund hat sie sich entschlossen, eines der Gesichter der Kampagne #Gewaltangehen zu werden, eine Initiative der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, um auf die belastende Situation aufmerksam zu machen. Auch wenn sich an der Problematik bisher nichts geändert hat, so ist sie doch froh, dass durch die Kampagne zumindest eine Debatte angestoßen wurde.
Doch wer sind diese Menschen, die Helfern wie ihr solche Feindseligkeit entgegenbringen? „Da gibt es kein Muster”, so Schätz. „Verbale Gewalt kriegt man von überall. Ich glaube, die Menschen werden immer unzufriedener und egoistischer und lassen ihren Frust an anderen aus”, versucht sie, die Ursachen für die Taten zu erklären. Die Bandbreite reicht von sexistischen Sprüchen bis hin zu Beleidigungen und Beschimpfungen. Einen Vorfall, der sich erst vor wenigen Wochen ereignete und der sie persönlich sehr mitgenommen hat, beschreibt sie so: „Wir hatten in einem Einsatz eine Patientin in den Tod begleitet. Wir wollten sie eigentlich ins Krankenhaus bringen, sie ist aber leider vor Ort verstorben. Ich bin zwischenzeitlich von der Wohnung runter zum Krankenwagen gelaufen und wollte einen Stuhl holen, um sie transportieren zu können, da sie sehr schwach war. Kaum war ich am Wagen, wurde ich von einem Mann aufs Übelste angeschrien, was mir einfalle, auf der Straße zu parken, er wolle nach Hause und komme nicht durch. Ich hatte ihm entgegnet, dass es sich um einen Notfall handelt. Daraufhin hat er noch mehr geschrien. Ich habe den Wagen dann schnell umgeparkt und beim Vorbeifahren blieb er nochmal stehen, drehte das Fenster runter und blaffte mich an, wo ich meinen Führerschein gemacht hätte. All das, währenddessen oben in der Wohnung gerade eine Frau verstarb”.
Vorfälle wie diese sind keine Ausnahmen, sondern gehören gerade bei Rettungssanitätern zum Alltag. Doch auch Mediziner, Pfleger und Krankenschwestern in Regensburgs Kliniken können ein Lied davon singen.
Gewalttätiges Verhalten ist auch ein Problem in der klinischen Notfallmedizin
Dr. Markus Zimmermann, Leiter der Abteilung für Klinische Akut- und Notfallmedizin und der Notaufnahme am Universitätsklinikum Regensburg bestätigt die Vorwürfe. „Gewalttätiges Verhalten ist ein alltägliches Problem in der klinischen Notfallmedizin geworden”, berichtet er. „Körperliche Gewalt geht meistens von den Patienten selber aus. Häufig sind es junge Männer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Aber es gibt natürlich auch Angehörige, die zur Leitstelle in der Notaufnahme kommen und sehr aufgebracht sind, dass ihr Angehöriger so lange warten muss, während andere Patienten längst behandelt wurden. Das wird oft in einer Art und Weise verbalisiert, das nicht wertschätzend oder höflich, sondern als aggressiv wahrgenommen wird”.

© bigstock/Plyushkin
Die Ursache dieser Vorfälle sieht Dr. Zimmermann in der nervlich angespannten Situation, in denen sich viele Angehörige befinden und hat sogar Verständnis für die verbalen Entgleisungen. „Vielen sind die Abläufe in einer Notaufnahme nicht bewusst, denn hier werden Patienten nicht in der Reihenfolge des Erscheinens, sondern nach Dringlichkeit behandelt“, erklärt er. „Wenn man einen Fremdkörper im Auge hat, dann muss man auf den Augenarzt warten, ein Patient mit einem Herzinfarkt kommt natürlich sofort rein, auch wenn er eine halbe Stunde später gekommen ist. Da haben wir immer wieder Beschwerden,” erklärt der Mediziner.
In vielen Fällen lassen sich Angehörige die Situation erklären und beruhigen sich relativ schnell wieder. Manchmal wird die Situation jedoch auch brenzlig. „Da kommt es zu Aggressionen, zu verbalen Äußerungen und plötzlich nimmt ein Angehöriger das Handy raus, macht ein Foto von der Pflegekraft und sagt: Ich weiß, wie Sie heißen, ich finde schon raus, wo Sie wohnen”!
Dass solche Drohungen nicht spurlos an einem Menschen vorübergehen, kann man sich vorstellen. Laut Dr. Monika Schanderl, Diplom-Psychologin und Akademische Rätin an der Universität Regensburg, ist das Spektrum an Folgebeschwerden – ausgelöst durch physische und psychische Gewalt – sehr groß und kann von sozialen Ängsten, Schlafstörungen und Suchtproblemen bis hin zu Angstzuständen, Depression und Posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) reichen.
Eine rechtliche Handhabe ist jedoch äußerst schwierig, denn die Auswirkungen verbaler Gewalt sind nur sehr schwer zu beziffern, zumal das Opfer in der Beweispflicht steht. Somit werden viele Fälle erst gar nicht gemeldet und laufen somit in keine Statistik ein.
Wie kann man Klinikpersonal besser schützen?
Aufgrund der steigenden Zahl an Beschwerden werden medizinischen Angestellten inzwischen Selbstverteidigungskurse angeboten. Doch Dr. Zimmermann zweifelt an dieser Herangehensweise: „Ich will keine Selbstverteidigungskurse. Wir brauchen auch keine Videoüberwachung oder abgeschottete Sicherheitsbereiche. Ich weigere mich ein bisschen, das als Normalität anzuerkennen. Wir müssen Strategien finden, um das Krankenhaus für die Menschen, die hier arbeiten, sicher zu machen”.

© bigstock/dissx
Um dies zu gewährleisten, wurden in der Uniklinik und vielen anderen Krankenhäusern bereits zahlreiche bauliche Veränderungen durchgeführt. Um eine Überfüllung des Wartebereichs – vor allem durch Patienten, bei denen kein medizinischer Notfall vorliegt – zu vermeiden, haben Notaufnahmen heute eine Zutrittsbeschränkung. Somit kann genau kontrolliert werden, wer ein- und ausgeht. Darüber hinaus durch laufen Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern Deeskalationstrainings, um gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen und Vorfälle zwischen Mitarbeitern und Patienten oder deren Angehörigen möglichst vermeiden zu können. Für den Fall, dass eine Situation außer Kontrolle gerät, gibt es Notfalltelefone und Alarmweiterleitungssysteme, die das Krankenhaus umgehend mit der nahegelegenen Polizeiwache verbinden.
Wir brauchen wieder ein respektvolles Miteinander
Körperliche Angriffe kommen Gott sei Dank nur selten vor. Vor allem die erfahrenen Fachkräfte im Team von Dr. Zimmermann sind sehr geschickt darin, po¬tentiell gefährliche Situationen frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen. Auffällig ist dabei, dass das Pflegepersonal – traditionell mit einem hohen Anteil an Frauen – fünfmal so oft von verbaler Gewalt betroffen ist wie die Ärzteschaft im Team.
Wie kann man mit diesem Problem also umgehen? Eine konsequentere Strafverfolgung ist sicherlich notwendig, doch bei Weitem nicht ausreichend. Dr. Monika Schanderl setzt vielmehr auf Prävention. Schulische Programme, die v. a. in den 2000ern gestartet wurden, spiegeln sich in rückläufigen Zahlen der Jugendkriminalität wider. Hier sollte also angesetzt werden, am besten in Kooperation mit den betroffenen Organisationen wie Polizei, Rettungskräften und Medizinern, um eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen.
Auch Dr. Zimmermann setzt auf einen gemeinschaftlichen Ansatz: „Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens. Wir akzeptieren keine Gewalt, weder im Krankenhaus, noch gegen die Polizei, den Rettungsdienst, die Feuerwehr oder gegen andere Menschen“.
Sara Schätz kann dem nur zustimmen: „Ich wünsche mir einfach wieder mehr Menschlichkeit. Ich mache meinen Job von Herzen gerne und brauche dafür keine Unterstützung und kein Händeklatschen. Aber ich wünsche mir einfach wieder mehr Respekt und Wertschätzung zurück und dass die Menschen wieder mehr auf Ihre Mitmenschen achten”.
Ein Report von Kathrin Gnilka | filterMagazin