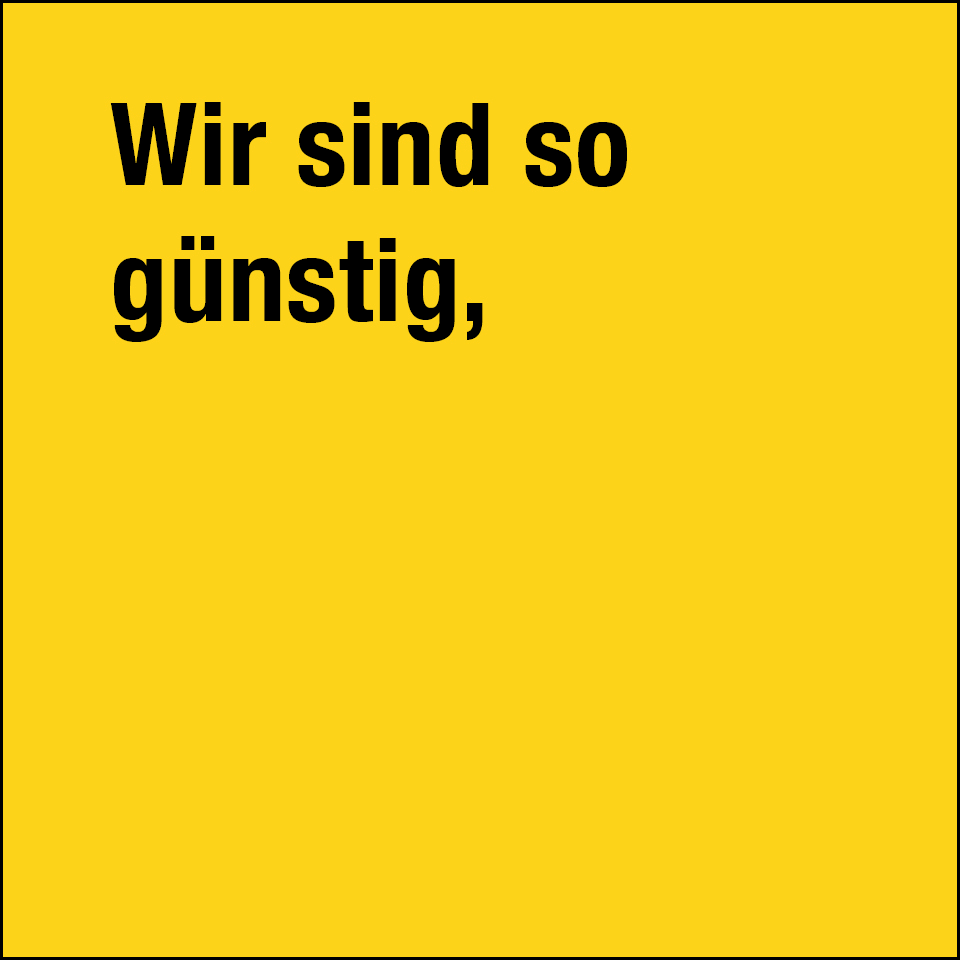Frau Dr. Freudenstein, Sie sind Ihren Worten nach kein „Regensburger Gewächs“. Was hat Sie nach Regensburg verschlagen?
Ich bin zwar weder in Regensburg geboren noch aufgewachsen, lebe aber schon seit 20 Jahren hier. Mein Mann und ich wollten einfach sehr gerne in Regensburg leben. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man ein paar Kilometer von Niederbayern die Donau entlang nach Regensburg zieht. Regensburg war ja schon immer ein Zentrum für ganz Ostbayern. Als Kinder haben wir beispielsweise schon Ausflüge zur Walhalla gemacht, und meine Schwester hat auch in Regensburg studiert. Inzwischen habe ich quasi die halbe Familie hier.
Germanistik, Geografie, Wirtschaft, über zehn Jahre beim Bayerischen Rundfunk, Lehrauftrag an der Universität Regensburg, Stadträtin, Bundestagsabgeordnete und jetzt Bürgermeisterin, dazu Mutter eines Teenagers – eine sehr vielseitige Arbeitsbiografie. Was davon bereitet Ihnen am meisten Freude?
Alle Bereich, in denen ich tätig war, hatten immer eines gemeinsam: Sie haben alle sehr viel mit Menschen zu tun – also sowohl im Journalismus als auch an der Universität. Mein Berufspolitiker-Dasein unterscheidet sich davon auch nicht so sehr. Und auch ob man jetzt Abgeordnete oder Bürgermeisterin ist, man hat immer sehr viel mit Menschen und mit den unterschiedlichsten Themen zu tun. Eigentlich ist das so wie im Journalismus, man wechselt nur die Schreibtischseite.
Zu Ihrer Rolle als ehemalige Journalistin: Wie betrachten Sie die Berichterstattung während der sogenannten Korruptionsaffäre aus der Warte des Journalisten und wie aus der Warte des Politikers?
Die hab ich ja nun überwiegend aus Berliner Perspektive noch mitbekommen: Und es ist nicht so, dass das, was in Regensburg passiert ist, überall passiert. Dieses „Das ist bestimmt überall so“ hat sich in Regensburg ja irgendwie manifestiert. Aber ich habe in ganz Berlin niemanden getroffen, der mir jemals zugeraunt hätte: „Jaja, kenn’ ich schon.“ Als publik wurde, was in Regensburg so passiert ist, wurde ich angesehen, als käme ich von einem anderen Planeten. Es gibt in Deutschland auch keine Stadt von der Größe Regensburgs, in der die Wahlkämpfe eine Million gekostet hätten. Das gibt es einfach nirgends. Insofern denke ich, dass das wieder auf Normalzustand zurückgeführt werden muss. Und die Berichterstattung: Ich denke, die war überwiegend in Ordnung. Den Prozess an sich habe ich im Klein-Klein nicht verfolgt.
Denken Sie, der Prozess hat Regensburg geschadet?
Normalerweise tritt man in der Situation zurück, dann hätte es der Stadt nicht geschadet. Politiker treten in der Situation immer zurück, um den Schaden vom Staat, von der Republik, der Stadt abzuwenden, und nicht weil sie etwas ausgefressen haben. Fast nie ist jemand zurückgetreten, weil etwas gerichtlich verurteilt gewesen wäre, sondern immer nur, um den Schaden abzuwenden.
Nehmen Sie es Joachim Wolbergs übel, dass er nicht zurückgetreten ist?
Dieses Thema interessiert mich nicht mehr.
Zurück zu Ihnen: Wie schwer ist es für Sie persönlich, Familie und Politik zu vereinbaren?
So etwas geht sowieso nur, wenn die Familie mitmacht, und bei mir war das der Fall: Mein Mann war immer sehr flexibel, und wir haben ein unkompliziertes Kind, das jetzt aber auch schon 16 Jahre alt ist. Bei uns war es die glückliche Fügung, dass wir Familie und Arbeit immer mit einer sehr großen Portion an Flexibilität organisieren konnten. Als Politiker hat man aber ehrlicherweise auch Privilegien: Es gibt ganz viele Menschen, die müssen um 8 Uhr in der Arbeit sein – und als Berufspolitiker hat man dann doch noch ein bisschen die Freiheit, Prioritäten setzen und Termine schieben zu können. Wenn mein Sohn Geburtstag hat, wird beispielsweise erst die Torte gegessen und dann ins Büro gegangen. Bis jetzt gab es auch noch keinen Geburtstag unseres Sohnes, an dem wir nicht alle da gewesen wären. Man muss aber auch so flexibel sein, weil man eben kein reguläres freies Wochenende hat und Abendtermine natürlich auch keine Seltenheit darstellen.
Ihr Vater war quasi selbst Bürgermeister seiner Gemeinde und über drei Jahrzehnte im Gemeinderat aktiv. Dachten Sie jemals, Sie würden gewissermaßen in seine Fußstapfen treten? Und was hielten Sie als Kind von der Politik?
Ach, bei uns ist immer viel diskutiert worden – wir waren ja fünf Kinder. Und am Familientisch ist immer viel über Politik geredet worden: sehr konträr und sehr leidenschaftlich. Es wurde auch sehr oft über Weltpolitik wie die Nato geredet, obwohl mein Vater eigentlich nur Gemeinderat in einer ganz kleinen Gemeinde war. Aber das war etwas, an dem sich auch immer die ganze Familie beteiligt hat. Angestrebt habe ich eine Karriere als Politikerin aber nicht. Ich bin auch die einzige Berufspolitikerin in der Familie. Alle anderen hatten das immer ehrenamtlich gemacht.
Sie sind auf einem Bauernhof in einer großen Familie aufgewachsen. Wie darf man sich Ihre Kindheit vorstellen?
Ich glaube, ich hatte eine glückliche, idyllische Kindheit mit viel Platz und viel Freiheit. Ich bin ja auch die Jüngste von uns, was heißt, dass meine Eltern eine große Liberalität bei mir hatten (lacht). Es war sehr spannungsfrei und wir durften auch Dinge, bei denen heutige Eltern wohl vor dem Jugendamt landen würden. Im Alter von 14 Jahren sind meine beste Freundin und ich beispielsweise in den Sommerferien für vier Wochen allein mit der Bahn durch ganz Deutschland gereist. Ich bin auch schon als Kind sehr früh überall mit dem Fahrrad hingefahren – auch an allen Bundesstraßen. Vielleicht war das alles aber auch noch weniger gefährlich als heute.
Genießt Ihr Sohn ebenso viele Freiheiten wie Sie früher?
Ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen von heute einen weitaus geringeren Bewegungsradius, weniger Freiheiten und vielleicht auch weniger Eigenverantwortung haben als früher. Aber mein Sohn durfte beispielsweise auch schon im Grundschulalter zur Grundschule radeln, was ja heute gar keiner mehr darf. Und in zehn Jahren habe ich ihn kein einziges Mal zur Schule gebracht. Er muss bei Regen und Wind immer schauen, dass er dort hinkommt. Im Alter von zwölf Jahren ist er nach einem gemeinsamen Urlaub auch schon mal alleine mit dem Zug von Sylt nach Berlin gefahren, weil er noch länger bei unseren Freunden bleiben wollte. Die haben ihn reingesetzt und wir dann abgeholt, was soll dabei schon passieren? Gut, dass es damals unterwegs plötzlich einen Achsbruch gab und unser Sohn auf einer Insel festsaß, hatte wirklich niemand geahnt, und sowas kommt ja eigentlich auch nicht vor (lacht). Aber auch das haben wir dann irgendwie organisiert bekommen. Und ich denke mir immer, irgendwann ist unser Sohn 18 und dann kann er nicht das erste Mal alleine mit dem Zug fahren. Außerdem wächst man auch an solchen Ereignissen.
Sie sind praktizierende Katholikin und gehen öfter in die Kirche als nur an Weihnachten und Ostern. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?
Eine wichtige, weil ich tatsächlich denke, dass die Orientierung am christlichen Menschenbild richtig und wichtig fürs Politik-Machen ist. Darunter fällt natürlich auch die christliche Soziallehre, die besagt, dass jeder Mensch die Chance braucht, sich selbst helfen zu können. Und weil ich mir denke, jeder Mensch, der mir begegnet, ist vom lieben Gott so gemacht worden, und er wird sich schon etwas dabei gedacht haben – also auch bei denen, die mich nerven (lacht).
Als zweite Bürgermeisterin sind Sie auch für den Bereich Sport zuständig. Würden Sie sich selbst eher als sportlich oder eher als Couch-Potato bezeichnen?
Früher habe ich richtigen Vereinssport gemacht – Volleyball, Tennis und so weiter. Das alles geht jetzt beruflich und zeitlich nicht mehr. Ich fahre aber sehr viel Fahrrad und wandere auch sehr gern. Eine Couch-Potato bin ich gar nicht. Und wenn ich mich aufs Sofa lege, dann schlafe ich auch sofort ein – unmittelbar quasi (lacht). Sport halte ich aber auch für gesellschaftlich wichtig. Er ist eine echte Volksbewegung, bei der sich alles zusammentut: Reiche, Arme, Junge, Alte, Profis, Amateure – Sport ist einfach etwas unwahrscheinlich Soziales und Verbindendes. Beim Fußball zum Beispiel kommen die Leute zusammen. Da haben auch große Vereine wie der Jahn oder die Eisbären eine wichtige Funktion, weil sie nach wie vor Gemeinschaft herstellen. In vielen Dingen sind wir sehr individualistisch unterwegs, jeder macht sein eigenes Ding oder lädt sich sein eigenes Fernsehprogram runter. Früher gab’s noch mediale Dinge, die die Menschen verbunden haben. Bei „Wetten, dass…?“ saßen damals alle am Samstag vorm Fernseher und am Montag konnte man darüber reden. Das ist ja alles vorbei. Aber das Fußballspiel vom Samstag verbindet nach wie vor. Darüber kann man noch am Montag reden. Der Sport schafft nach wie vor verbindende Ereignisse.
Als Bundespolitiker ist man im Vergleich zur Stadtspitze für den Bürger eher unsichtbar. Welche Arbeit gefällt Ihnen besser: Kommunalpolitik oder Bundespolitik? Und was sind die jeweiligen Vorzüge?
Da spreche ich jetzt auch als Medienwissenschaftlerin: Dass man für die Bürger als Bundespolitiker „unsichtbarer“ wäre, ist mediale Wahrnehmung. Ehrlicherweise muss man sagen, dass es die Bundestagsabgeordneten nicht gerade leicht haben, weil sie viel für ihre Region unternehmen, es aber keinen Niederschlag in den Zeitungen findet. Der Ausbau der A3 ist beispielsweise vornehmlich das Ergebnis meiner Arbeit, nur wurde das so in den Zeitungen kaum geschrieben. Als Bürgermeisterin kann ich aber viel mehr unmittelbar bewegen. Es sind auch die Wege kürzer, und die Dinge werden schneller erledigt, weil man schnell wo anrufen und um etwas bitten kann. In Berlin ist es natürlich immer etwas komplizierter, die Gespräche dauern länger oder die Personen sind länger nicht erreichbar. Die Unmittelbarkeit in der Kommunalpolitik finde ich sehr schön.
Sie waren über ein Jahrzehnt als Journalistin tätig. Somit sind Sie sowohl mit der journalistischen Arbeitsweise also auch mit dem Ethos vertraut. Wie stark hat sich Ihre Arbeit als Politikerin auf Ihr Verhältnis zum Journalismus ausgewirkt?
Man hadert mehr, wenn Fehler auftreten (lacht). Und manchmal hab ich auch den Eindruck, Politiker haben regelrecht Angst vor Journalisten. Das hab ich beispielsweise jetzt nicht, weil ich die andere Seite kenne. Ich weiß, dass sind auch nur Menschen, die in der Regel ihre Zeitung schreiben und ihr Programm füllen müssen. Politiker unterstellen dem Journalismus ja manchmal, dass etwas nur geschrieben wird, um ihnen zu schaden. Das gibt es zwar auch, aber es ist nicht grundsätzlich so. Ich weiß, wie vieles vonstattengeht, und das hilft im täglichen Umgang miteinander. Ansonsten hadere ich ein wenig mit dem Trend zur Schnelligkeit und zur Kürze – oder besser der Verkürzung.
Was hat Ihnen während des Lockdowns am meisten gefehlt?
Ich habe die Zeit auch genossen, weil man in der Familie mehr Zeit füreinander hatte. Was mir aber wirklich gefehlt hat, war die Möglichkeit, meine Mutter zu besuchen. Die ist 84 Jahre alt. Insgesamt habe ich es aber eher als großes Plus an Zeit erlebt, was nicht nur unangenehm war.
Welches bayerische Sprichwort beschreibt sie am besten?
„Mit’m Red’n kemma d’Leit zam.“ Weil gerade, wenn man mit den Leuten redet, lässt sich vieles klären. Auch hier in meinem Bürgermeisteramt telefoniere ich sehr viel oder suche den direkten Kontakt. Das ist auch viel einfacher als in irgendwelche E-Mail-Korrespondenzen einzusteigen.
Willibald J. Ferstl - RNRed